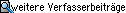|
Sprache und Logik
Vielen Dank, Frau Popp, für Ihre ausführliche und sehr interessante Antwort („Re: Re: Re: Wortbildung und Schreibkonvention“)! Da sie viele Aspekte birgt, werde ich nach und nach jeweils darauf eingehen.
Zitat:
Ursprünglich eingetragen von Margret Popp
[J.-M. W.:] Nimmt man diese Aussage als eine vom Typ „wenn A, dann B“ (hier: wenn etwas [nach außerschriftlichen Kriterien] ein Wort ist, dann wird es zusammengeschrieben), dann ist die (im Sinne der Aussagenlogik) zugehörige Negation vom Typ „wenn nicht B, dann nicht A“.
Ich will gegen diesen Ihren Satz keinen Einwand erheben, möchte aber darauf hinweisen, dass die Sprache nicht so säuberlich gebaut ist, wie Sie möglicherweise annehmen.
Zunächst einige Bemerkungen zur Logik an sich. Wenn einem das beim Lesen zuviel wird, kann man es von da ab überpringen, wo man die Lust verliert; weiter unten gehen ich darauf ein, was das Ganze mit Sprache zu tun hat.
Werden zwei Aussagen, deren Wahrheitswert unmittelbar feststeht und der entweder falsch oder wahr ist, durch eine Subjunktion (Zeichen „–>“) verknüpft, dann ist die dadurch entstehende Gesamtaussage immer wahr, es sei denn, daß die erste Teilaussage falsch und die zweite wahr ist. Das ist zwar nur eine Definition, und sie wirkt auf den ersten Blick etwas befremdlich, aber daß sie sinnvoll ist, kann man sich an einfachen Beispielen leicht klarmachen. Etwa so:
„Wenn es morgen stark regnet, [dann] gehen wir nicht in den Zoo.“ Das zerfällt in die Aussagen A: „Morgen regnet es stark“ und B: „Wir gehen morgen nicht in den Zoo.“ Es gibt folgende Fallgruppen: (i) Am nächsten Tag regnet es nicht (oder nur schwach). Dann ist es egal, ob diejenigen, auf die sich das „wir“ bezieht, an dem Tag in den Zoo gehen oder nicht: Die obige Wenn-dann-Aussage bleibt davon unberührt, die Tatsachen widersprechen ihr in beiden Fällen nicht, und deshalb gilt sie in diesen Fällen als wahr. (Daran sieht man: Aus einer falschen [unzutreffenden] Aussage folgt Beliebiges [Wahres oder Falsches; man weiß nichts über den Wahrheitswert].) (ii) Am nächsten Tag regnet es stark. Das ist der Fall, auf den sich die Gesamtaussage bezieht, und also ist nun Teil B relevant. Gehen die mit „wir“ bezeichneten Personen dann doch in den Zoo, steht das im Widerspruch zur Aussage B. Dadurch wird die gesamte Aussage falsch, die ja für genau diesen Fall das genaue Gegenteil angekündigt hat. Gehen „wir“ dann nicht in den Zoo, ist die zusammengesetzte Aussage offenbar wahr.
Hinter dieser Argumentation steckt noch das Prinzip der Negation in der Aussagenlogik, daß eine Aussage, die man als nicht falsch identifiziert hat, wahr sein muß und umgekehrt (was nicht wahr ist, ist falsch). – Übersichtlicher wird das mittels einer Wahrheitswertetabelle. Das Zeichen für die Negation ist „¬“ (unter HTML mittels des Befehls „¬“ bzw. „¬“ erzeugbar), die Wahrheitswerte falsch und wahr werden durch „f“ und „w“ abgekürzt. Diese Tabelle ist so zu lesen: In den ersten beiden Spalten ganz links stehen die möglichen Wahrheitswerte von A und B, aus deren Kombination sich die vier hier zu betrachtenden Fälle ergeben. In allen weiteren Spalten sind die resultierenden Wahrheitswerte des im Spaltenkopf angegebenen logischen Ausdrucks angegeben. | A | B | A –> B | ¬A | ¬B | (¬A) v B | (¬B) –> (¬A) |
| w | w | w | f | f | w | w |
| w | f | f | f | w | f | f |
| f | w | w | w | f | w | w |
| f | f | w | w | w | w | w |
Man sieht, daß man das Resultat der Subjunktion „A –> B“ auch dadurch erhält, daß man die Spalten „¬A“ und „B“ mittels eines einfachen oder (lat. vel, Zeichen „v“) verknüpft. Eine derart gebildete Aussage ist insgesamt wahr, wenn eine (oder beide) Teilaussage(n) wahr ist (sind). Weil es bei der Oder-Aussage nicht auf die Reihenfolge der Teilaussagen ankommt, kann ich den Bezug zu der Reihenfolge in der Subjunktion (bei der es auf die Reihenfolge ankommt!) vertauschen. Jetzt steht es so da, daß die negierte erste Aussage mit der unveränderten zweiten Aussage per oder verknüpft ist. Beim Tausch der Rollen von erster und zweiter Aussage ist also „¬A“ als die zweite und „B“ als die Negation der ersten Aussage zu verstehen.
Wovon aber ist „B“ die Negation? Nun, offenbar von „¬B“, denn die doppelte Negation ändert den Wahrheitswert zweimal in sein Gegenteil und läßt ihn damit unverändert. Es gilt: ¬(¬B) <=> B. Das Zeichen „<=>“ steht für die Äquivalenz, d. h. die logische Gleichwertigkeit zweier Ausdrücke, unabhängig davon, welchen Wahrheitswert sie jeweils annehmen. [Bei Zahlen würde man ein Gleichheitszeichen schreiben; die Entsprechung zur doppelten Verneinung ist offenbar -(-a)=a.] Daraus folgt: Wenn ich (¬A) als zweiten Teil der Subjunktion ansehe, ist (¬B) der zugehörige erste Teil, ohne daß sich an der Gesamtaussage etwas ändert. Es gilt also folgende Kette logischer Äquivalenzen:
A –> B <=> (¬A) v B
<=> ¬(¬B) v (¬A) <=> (¬B) –> (¬A).
Ich muß mich also dringend korrigieren! Was ich geschrieben hatte, war ein gedanklicher Lapsus: Zitat:
Nimmt man diese Aussage als eine vom Typ „wenn A, dann B“ (hier: wenn etwas [nach außerschriftlichen Kriterien] ein Wort ist, dann wird es zusammengeschrieben), dann ist die (im Sinne der Aussagenlogik) zugehörige Negation vom Typ „wenn nicht B, dann nicht A“.
Das ist offenbar falsch, denn es handelt sich bei „wenn nicht B, dann nicht A“ gar nicht um die Negation der Aussage „wenn A, dann B“, sondern um ein logisches Äquivalent derselben Aussage. (Daß hier nicht auftaucht, hat mit einer eventuellen Negation der Gesamtaussage nichts zu tun!) Meine weitere Argumentation beruhte aber auf der Äquivalenz der beiden Aussagen »Wörter werden zusammengeschrieben« und »Was getrennt geschrieben wird, ist eine Wortgruppe«, daher ändert sich daran nichts.
Was hat nun das alles mit Sprache zu tun? Garnichts!! Deshalb kann man daraus, daß man sich dieser logischen Konstrukte bedient, auch nicht ableiten, damit würde der Sprache eine entsprechende Regelhaftigkeit unterstellt werden. Was Sie sagen, Frau Popp, stimmt genau: daß die Sprache eben nicht so säuberlich und klar gebaut ist wie die mathematische Logik.
Ich wollte mit meiner Argumentation (unter „Re: Re: Wortbildung und Schreibkonvention“) auf etwas ganz anderes hinaus: Sobald man die Ebene der Sprache an sich, d. h. der konkreten Beispiele, verläßt und seine Beobachtungen systematisiert, trifft man Aussagen über die Sprache, die sich anhand der vorgefundenen Beispiele als zutreffend oder unzutreffend erweisen. Mithin gelten für diese Metaebene die Prinzipien der Aussagenlogik. Also: Nicht die Sprache selbst ist es, die säuberlich gebaut ist, sondern ihre Beschreibung muß es sein! Logisch inkonsistente Aussagen sind unbrauchbar, das gilt für jede Wissenschaft – sonst wäre das jeweilige Gebiet keine. An diesem Punkt ist die Unterscheidung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften (die ja heutzutage auf eine Trennung hinausläuft) hinfällig.
(Natürlich treten ab und zu Widersprüche auf, und auch die Physik ist nicht frei davon. Das tut aber der Tatsache keinen Abbruch, daß die Physik eine wissenschaftliche Disziplin ist [im Unterschied etwa zu künstlerischen Disziplinen]. Im Gegenteil: Dort, wo Unerwartetes eintritt oder grundsätzliche Aussagen in Konflikt miteinander geraten, kann man sehr viel lernen, denn dann müssen diese Widersprüche gelöst bzw. erklärt werden. Die Entwicklung der Quantenmechanik geht beispielsweise letztlich auf die Notwendigkeit zurück, fundamentale Widersprüche der sogenannten klassischen Physik auflösen zu müssen.)
__________________
Jan-Martin Wagner
|