
Forum (http://Rechtschreibung.com/Forum/index.php)
- Dokumente (http://Rechtschreibung.com/Forum/forumdisplay.php?forumid=1)
-- Historische Trouvaillen (http://Rechtschreibung.com/Forum/showthread.php?threadid=71)
eingetragen von Sigmar Salzburg am 28.08.2021 um 09.41
Angeregt durch Dr. Wolfgang Prabels Erwähnung des „Monte Verità“in geolitico.de fand ich bei Wikipedia:
Musiklehrerin Ida Hofmann und der belgische Industriellensohn Henri Oedenkoven gründeten mit anderen gleichgesinnten ... eine Siedlungsgemeinschaft auf zunächst veganer und später vegetarischer Grundlage, und gaben dieser 1902 den Namen Monte Verità. ... Ida Hofmann schrieb später in der hauptsächlich von Oedenkoven entwickelten neuen ortografi:Einer der ersten Besucher war der Lebens- und Schreibreformprophet gustaf nagel vom Arendsee.«Die bedeutung des fon uns gewälten namens der anstalt [ist so] zu erklären, das wir keines wegs behaupten, die ‹warheit› gefunden zu haben, monopolisiren zu wolen, sondern dass wir entgegen dem oft lügerischen gebaren der geschäftswelt u. dem her konvenzioneler forurteile der geselschaft danach streben, in wort u. tat ‹war› zu sein, der lüge zur fernichtung, der warheit zum sige zu ferhelfen.»Vorbilder des Siedlungsprojekts Monte Verità gab es bereits. Dazu gehörte unter anderen die einige Jahre zuvor gegründete Oranienburger Obstbau-Kolonie Eden e.G.m.b.H.
– Ida Hofmann
eingetragen von Sigmar Salzburg am 24.04.2021 um 06.31
* 10 v. Chr. in Lugdunum (Lyon); † 54 n. Chr.
Neben seinen schriftstellerischen Tätigkeiten plante er eine Reform des Lateinischen Alphabets durch Hinzufügung dreier neuer Buchstaben. Der erste – Ɔ (antisigma) – entsprach einem gespiegelten lunaren Sigma und stand sehr wahrscheinlich für den Lautwert des griechischen Psi. Der zweite – Ⅎ (digamma inversum) – war dem archaischen griechischen Digamma nachempfunden, jedoch gedreht; er sollte zur Kennzeichnung des Lautes [v] im Gegensatz zu [u] und [w] (durch den Buchstaben V) dienen. Der dritte – Ⱶ – ähnelte einem halben H und diente für den Laut zwischen [u] und [i], analog zum griechischen Ypsilon. Die Reform führte er während seiner Zensorschaft ein, doch sie konnte sich nicht durchsetzen. Da das klassische Latein ohne Wortabstand geschrieben wurde, versuchte er, die alte Sitte des Setzens von Punkten zwischen den Wörtern wieder einzuführen. [Wikipedia]
Nach Patrick Bahners plante auch Helmut Kohl um 1968 eine Rechtschreibreform: „Im Mantel der Geschichte: Helmut Kohl oder Die Unersetzlichkeit, Berlin: Siedler,1998, S. 66f.,“ aber es war wohl zunächst nur der dumpfe Wille da – der später der Reformersekte den Zugriff in die Politik erleichterte.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 19.04.2021 um 06.28
Scinexx berichtet über den Fund eines 3450 Jahre alten Fragments in Alphabetschrift:
Das 2018 in Tel Lachisch entdeckte Keramikfragment ist knapp vier Zentimeter groß und wurde zwischen den Resten einer Stadtmauer und eines größeren Gebäudes gefunden. Auf seiner Innenseite sind eine Handvoll mit dunkler Farbe geschriebene Buchstaben zu sehen. „Man erkennt zwei Reihen mit jeweils drei Buchstaben“, berichten die Forscher. Zwei weitere Zeichen stehen seitlich davon, ein drittes zwischen den beiden Zeilen.Im Schnell-Lexikon „Wiki“ wird dieser Fund von Lachisch (hebräisch לכיש, laḵîš; akkadisch URULakišu) bereits erwähnt. Zu gleicher geschichtlicher Zeit war 500 km weiter nördlich in Ugarit schon ein Alphabet von der Keilschrift abgeleitet worden, wurde aber nach der Zerstörung der Stadt nicht weiterentwickelt.
Frühester Beleg fürs Alphabet
Das Spannende aber ist die Form der Buchstaben: Sie sind bereits klar als alphabetische Zeichen zu identifizieren. Die erste Zeile besteht aus den Buchstaben Ayin, Bet und Dalet. Rückwärts könnte sich daraus das Wort Sklave ergeben – ein häufiger Namenszusatz im frühen semitischen Sprachgebrauch, wie die Archäologen erklären. In der zweiten Zeile ergeben die Buchstaben Nun, Pe und Tav. Dies ergibt je nach Leserichtung das Wort für Honig/ Nektar oder aber eine Ableitung des Verbs „drehen“.
„Diese Keramikscherbe ist eines der frühesten sicher datierten Beispiele für alphabetische Schrift, die in Israel gefunden wurde“, berichtet Höflmayer...
scinexx.de 19.4.2021
eingetragen von Sigmar Salzburg am 02.04.2020 um 19.16
Pandemie vor 300 Jahren – die Ur-Tageszeitung berichtet
Von Pandemie bis Monarchie – über was die älteste noch heute existierende Tageszeitung der Welt vor rund 300 Jahren berichtete, kann nun jeder digital nachlesen: Österreichische Wissenschaftler haben zahlreiche historische Ausgaben des Wien[n]erischen Diariums im Volltext online zugänglich gemacht. Heute ist das Blatt unter dem Namen „Wiener Zeitung“ bekannt.
Seit der Erfindung des Buchdrucks hatten sich die Formate der frühen Printmedien stetig weiterentwickelt – im Jahr 1703 führte diese Entwicklung dann zu einem Druckwerk der besonderen Art: Am 8. August erschien die erste Ausgabe einer Tageszeitung, die von da an bis heute kontinuierlich berichtete – das Wien[n]erische Diarium. 1780 bekam das Blatt schließlich den Namen Wiener Zeitung, den es bis heute trägt.
Digitales Blättern in Zeitdokumenten
Dass sich seit seiner Gründung sämtliche Ausgaben erhalten haben, macht die Wiener Zeitung zu einer historischen Quelle von besonderem Wert. Viele geschichtliche Ereignisse und Personen werden erwähnt und auch die Veränderungen der Sprache sowie die Entwicklung des Journalismus spiegeln sich in den historischen Ausgaben wider. Die Dokumentensammlung ist dadurch eine wichtige Informationsquelle für zahlreiche geisteswissenschaftliche Fragestellungen.
Aus diesem Grund haben sich Forscher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zum Ziel gesetzt, die Texte leichter lesbar und für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen...
Beispiele mit Bezug zur Corona-Krise
Beim digitalen Blättern durch das Diarium kann man feststellen, dass die Bandbreite der Themen durchaus mit der heutiger Zeitungen vergleichbar war. Aus aktuellem Anlass der Corona-Krise hebt das ÖAW die Berichterstattung über Pandemien hervor. In einer Ausgabe aus dem frühen 18. Jahrhundert heißt es beispielsweise: Es wird verlautbart, dass „wegen der in Frankreich grassirenden Pest / weder Personen / Vieh / noch Waaren / von dorten“ einreisen dürften. An einer anderen Stelle heißt es, dass „allda niemand Frembder / ohne sichern Paß / wegen der anderwerts im Schwung gehenden bösen Seuche / eingelassen werde“.
Diese Maßnahmen kommen uns heute in gespenstischer Weise vertraut vor. [...]
Abschließend berichtet das ÖAW – erneut mit Blick auf die Corona-Krise – von einer ermutigenden Meldung aus dem Diarium bezüglich des Endes einer Pandemie im Jahr 1722. So war am 11. November zu lesen: „daß die Seuche an allen Orten von Provence und Languedoc völlig aufgehört / und […] daß jene Stadt / in welcher dieselbe so sehr gewütet / nunmehro davon befreyet seye.“
Quelle: Österreichische Akademie der Wissenschaften
DIGITARIUM – die digitale Ausgabe der historischen Zeitung Wien[n]erisches Diarium
wissenschaft.de 2.4.2020
An den Texten kann man sehen, daß die Rezensenten die Zitate möglichst hinter dem Komma und den neuen „dass“ haben anfangen lassen, damit die Leser nicht an die gute alte Rechtschreibung erinnert werden.
Der alte Text wäre uns ohne die Umerziehung, trotz sonstiger origineller kleiner Abweichungen, viel näher und vertrauter gewesen – eine echte kulturelle Tradition. Nur beim letzten Zitat klappte der Ersatz nicht, weil das „daß“ im Satz noch einmal vorkommt.
Die nichtsnutzige Dass-Reform ist nichts anderes als eine gewaltsame Kulturschurkerei, die von seltsamen Zirkeln gegen den Willen der meisten Leser ausgeheckt worden ist.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 18.03.2020 um 12.00
von Wilhelm Dreecken
Die Frage einer Reform der deutschen Rechtschreibung wird immer wieder erörtert; hier ein kleiner Beitrag zu diesem Thema.
Die Vorkämpfer für eine neue Rechtschreibung lassen sich meist von dem Motiv „schreibe, wie du sprichst“ leiten, indem sie mit einem Schein des Rechtes darauf hinweisen, daß unser primäres Ausdrucksmittel ja die Sprache und nicht eine Schreibe sei. Wollte man sich dieser Meinung anschließen, so würde es bald keine deutsche Sprache mehr geben, sondern der Oberbayer und der Rheinländer, der Berliner und der Alemanne, der Mecklenburger und der Sachse hätten jeder seine eigene Schriftsprache. Denn nur durch die Schrift läßt sich die hohe Form der Sprache festhalten, die der Vielfältigkeit landschaftlicher Mundarten gegenübersteht: das Hochdeutsche. Mundartliche Schrift hat ihre Berechtigung nur zur Wiedergabe der Mundart, die als solche eben vom Hochdeutschen abweicht; es sei an Fritz Reuter als Vertreter einer niederdeutschen und an Johann Peter Hebel als Vertreter einer oberdeutschen Mundart erinnert. Aber Goethe soll nicht in Berlin „Jöte“ und in Leipzig „Köde“ geschrieben werden!
Die Verfechter der Orthographie-Reform behaupten, eine Vereinfachung zu bringen; der Sprachfreund wird merken, daß es sich eher um eine Verarmung handelt. Durch Nachlässigkeit in der Aussprache haben wir schon so viel von dem Reichtum der Farbigkeit unserer Sprache verloren – wollen wir heute, mit einem ausgebildeteren Sprachgefühl, das bewußt fortsetzen, woran frühere Zeiten unbewußt sündigten?
Nehmen wir ein Beispiel: der Diphthong ai ist im Gotischen und Althochdeutschen zu finden, unser Diphthong ei meist aus dem langen i des Mittelhochdeutschen entstanden wie der Engländer das Zeichen i als „ei“ ausspricht, so spricht z.B. der Alemanne heute noch „i“, wo der Mittel- oder Niederdeutsche „ei“ spricht und im Hochdeutschen ei geschrieben wird. Im allgemeinen Bewußtsein ist aber dieser wesentliche Unterschied von ai und ei fast verschwunden und man betrachtet diese verschiedene Schreibweise nur noch als funktionell zur Unterscheidung, wie bei „Waise“ und „Weise“. Liliencron aber, dem wir wie so manchem anderen Dichter viel für die deutsche Sprache zu danken haben, schrieb konsequent (und begründete es wiederholt in seinem Briefwechsel) „Haide“, nicht im Unterschied zu „Heide“ (got. übrigens auch ai, aber schon ahd. ei), sondern im richtigen Sprachgefühl (got. haithi).
Wenn einmal eine Orthographie-Reform durchgeführt wird, dann möge sie (neben der Ausmerzung von Fehlern, wie z.B. früher des falschen th) nicht eine Verarmung, sondern eine Bereicherung unserer Sprache anstreben, wozu die Etymologie für die Schrift ebenso vielfältige Möglichkeiten bietet, wie die Besinnung auf die eigentliche Wortbedeutung für die Sprache. Aber auch heute kann für den denkenden Schreiber in Zweifelsfällen nur die Etymologie maßgebend sein, nie die Aussprache: wenn man weiß, was „Ärmel“ ist, kann man nie „Ermel“ schreiben.
Schwieriger erscheint die Frage bei Fremdwörtern. Der Verfasser erinnert sich, mit welchem Entsetzen er vor langen Jahrzehnten als Student bei einer Reise auf Hamlets Spuren im schönen Dänemark „Frisör“ und „Toalet“ las; nun, auch bei uns ist nicht nur seit langem schon das Comptoir zu einem „Kontor“ und in neuerer Zeit das Bureau zu einem „Büro“ geworden, sondern haben sich auch Wortungetüme wie „Friseurin“ statt Friseuse eingeschlichen. Das ist der Weg, auf dem Fremdwörter zu Lehnwörtern werden; dagegen läßt sich schließlich nur sagen, daß Wortbastarde auf jeden Fall vermieden werden sollten. Aber ist in einer voll entwickelten Sprache die Aufnahme von Lehnwörtern überhaupt wünschenswert? Wäre das nicht vielmehr ein Zeichen von Müdigkeit, Unfruchtbarkeit der Sprache, ihres Absterben, ein Zeichen dafür, daß ihr die Kraft zum Weiterwachsen fehlt? Denn die Sprache ist ein lebender Organismus, der seine Kraft aus dem gesunden Volksleben ebenso schöpft wie aus dem Schaffen der Einzelnen, die – nennen wir Luther, Goethe, Ranke – den Wortschatz vermehren und die sprachliche Ausdrucksmöglichkeit bereichern. Fremdwörter dagegen haben ihre Berechtigung, wenn sie – auch heute noch – zugleich mit ihrem Gegenstande in jede Sprache solcher Völker kommen, denen die sie bezeichnenden Begriffe neu sind: Wir nahmen von den Franzosen Cognac, sie nahmen von uns Bock (und bière, „Bier“ ist aber nicht deutschen, sondern vulgärlateinischen Ursprungs); die Beispiele ließen sich verzehnfachen (Akt, Drama, Möbel, Musik, Novelle, Oper, Papier, Poesie, Post, Roman, Schokolade, Tabak, Zigarre), in denen wir den Charakter als Fremdwörter noch ganz deutlich empfinden. Anders ist es, wenn diese sich zu einer Zeit, als unsere Sprache sich noch in einem frühen Stand der Entwicklung befand, zugleich mit ihrem Gegenstand in sie eingebürgert, die Entwicklung unserer Sprache mitgemacht haben und so zu Lehnwörtern geworden sind, wie zum Beispiel „Kaiser“, „Wein“ u.v.a., deren fremder Ursprung uns garnicht mehr bewußt ist.
So ist die Frage der Rechtschreibung auch hier ziemlich einfach: Lehnwörter schreiben wir in deutscher Art, Fremdwörter nach ihrer Art, denn sie sollen Fremdwörter bleiben. Der Vertreter der phonetischen Schreibweise („schreibe wie du sprichst“) käme gewiß in Verlegenheit, wenn er z. B. wegen „Gentleman“ befragt würde! Aber z. B. Meuble, Musique, Chocolat zu schreiben, wäre ein lächerliches Barockisieren, um so unberechtigter, als diese Wörter ebenso wenig französisch wie deutsch, sondern in allen lebenden Sprachen Fremdwörter sind. Ob wir aber Philosophie und Symphonie beibehalten oder uns nach Telefon oder Telegraf richten wollen, ob Coeln am Rhein oder Köln am Rhein (schließlich auch Frankfurt am Mein!) liegen soll, ist letzten Endes Geschmackssache. Was unz betrift: di direkziohn „gustaf nagel“ gefelt unz nicht.
Wilhelm Dreecken, geboren am 18. April 1887, aus einer alten Juristenfamilie stammend, wandte sich nach Besuch des Humanistischen Gymnasiums dem Verlegerberuf zu. Nach seiner Ausbildung studierte er Philosophie, Sprach- und Literaturwissenschaft. Dann brach er sein Studium ab, um einem Ruf des Berliner Verlages Schuster & Loeffler zu folgen, in dem er das Lektorat leitete...
(Pandora 1946, Seite 29 ff.)
eingetragen von Sigmar Salzburg am 09.01.2020 um 19.54
Mörder unserer Sprache
Es gibt Leute, die mit eigenen Mitteln und mit viel mehr Steuergeldern hohe und höchste Schulen besucht haben und stolz auf ihre Bildung sind. Sie sollten sich darum verpflichtet fühlen, ihr Licht leuchten zu lassen, zu Nutz und Frommen der geistig minderbemittelten Massen. Englischem Vorbild folgend, sollte die Überlegenheit vor allem an der Sprache erkennbar sein. Das Gegenteil ist oft der Fall: bei erster Gelegenheit verleugnen sie die paar Deutschstunden, während welcher sie nicht geschlafen haben, und schließen sich leichtesten Sinnes dem großen Heer der Sprachreisläufer an. Ich rede hier nicht von den fremden Wörtern und unbegrenzten Begriffen, die sie uns auf ihrem hohen Seil vorgaukeln, sondern von ihrem biedern Werktagsdeutsch, von dem, was „U" sein sollte, und von dem sie meinen, es erschließe der Jugend neue, unvorstellbare Gefilde der Sprachreinheit und -feinheit.
Solange wir ihnen nicht unter Zwang zuhören oder ihre Erzeugnisse lesen müssen, schaden sie nicht mehr als einige neudeutsche Dichter, Erzähler und Volkswirtschafter. Gemeingefährlich aber sind sie in den Augenblicken, wo sie sich bei Behörden, beim Funk, bei der Nachrichtenpresse oder als Entwerfer von Gesetzen und Verfasser offizieller Ansprachen eingenistet haben und alsdann tagein, tagaus, in Wort und Schrift, unmittelbar oder durch den Mund gefügiger Sprecher und geplagter Setzer, auf uns einhämmern dürfen oder müssen. Dagegen schützte nur ein Leben in der Wildnis. Ihre stolze Oberflächlichkeit, getarnt mit stiernackiger Rechthaberei, sagt ihnen, daß das, was sie über gutes Deutsch nicht wissen, auch ihre Leser und Hörer nicht wissen. Man erinnere sich, wie unbelehrbar sie wegen der „Meteorologischen Zentralanstalt" waren, wegen „gehe" statt „geh!", „Stop" statt „Halt", „gesendet" statt „gesandt", „Maternité" statt „Geburtenhaus" (die Geburts-, Schul-, Stadt-, Amts-, Kongreß-, Zucht-, Kranken-, Pfrund- und Armenhäuser sind uns auch heute noch gut genug) usw. Und dafür zahlen wir sie noch! Die Arbeit gewissenhafter Lehrer wird zuschanden; denn soll der Schüler glauben, was ihm der Lehrer angibt oder was eine nie irrende Obrigkeit funkt, auf Schilder malt und in Blättern ausschreibt? Pausenlos wiederholen sie, was falsch und häßlich ist und unser Sprachgefühl abstumpft und schließlich tötet.
Nach eigenem Behagen erdrosseln sie gute Alt-Ausdrücke und ersetzen sie durch „zeitgemäße", nicht immer aus verlorenem oder nie gehabtem Sprachsinn heraus; Ziererei, Neuerungssucht und Unsicherheit spielen mit. Ihre Neuheiten sind indessen meistens Nachäffereien, kein eigenes Gedankengut. Daß sie uns gerade die scheußlichsten Fänge aus irgendwelchen Tümpeln vorsetzen müssen, ob wir wollen oder nicht, steht gewiß in keinem Anstellungsvertrag. Leider habe ich noch nie einen Vertrag gesehen, in dem der Arbeitgeber bessere Kenntnisse der Muttersprache ausbedingt, als jeder Haudegen sie bietet.
Ehrfurcht vor alten Meistern? Abgestreift! Um dem heutigen hohen Stand der deutschen Sprache zu genügen, müßte der „Tell", nach ihrer Meinung, neu „überarbeitet" werden; Schiller überhaupt, schrieb er doch viel zu wenig „differenziert". Zu Fürst und Stauffacher spräche dann Attinghausen, stromlinig ausgerichtet auf das hinreißende Amts-, Funk-, Illustrierten- und Kinodeutsch: „seid euch einig, euch einig, euch einig!" (Im Appenzellerland ist man zwar heute, wie vor Jahrhunderten, „ähs worde", eins oder einig worden, wenn ein Händel erledigt oder ein Handel zustande gekommen war.) Man spricht nicht mehr miteinander, man bespricht sich. Ich hoffe, die Zeit nicht zu erleben, da man sich fröhlich ist, sich etwas Gutes ißt, sich lacht oder weint; ich will mich vorher sterben.
In den Fluten läppischer Blähungen, überflüssiger Vor- und Nachsilben, nichtssagender Abstraktionen, eitler und wüster Knäuelsätze sind Behörden, Marktschreier, Seelenkenner, Volks- und Funkredner bereits erstickt. Richter, Dichter und Prediger stehen auf Kragenhöhe drin. „Das Hauptthema war die deutsche Frage..." Wer auf das unfaßbare Allerweltswort „Frage" stößt, soll zuerst fragen, wer denn eigentlich wen und was fragt, Fall, Gegenstand, Sache oder Angelegenheit zählen nicht mehr; dafür haben wir das „Anliegen", das jedem salbigen Redner sein eigenes ist, in Verbindung mit „Verpflichtung" natürlich („Es ist mir Anliegen und Verpflichtung").
Eine der neuesten Bescherungen von oben herab sind die „Entwicklungsländer". Was sind denn die Vereinigten Staaten, England und die meisten europäischen Länder, die laufend Neues schaffen? Was sind Indien, Laos, Tibet, Iran, Ceylon, Ghana usw. usw., die trotz Hilfe stillstehen? – Neu ist auch der Beherrscher" an Statt des „Herrschers"; noch lange nicht jeder Herrscher beherrscht. – Ein hoher Beamter, Dr. phil., mahnte uns, „man müsse einander gegenseitig helfen", und fügte bei „... ich glaube, daß es genüge". Ich glaube, es genüge ohne das „daß"; oder Gautschi aus New York: „Kennedy und de Gaulle waren gegenseitig voneinander beeindruckt". Sagt man unter Freunden nicht einfach „sie hatten einen guten Eindruck voneinander"? Und Staub aus Paris: „man setze sich zusammen...". aus wieviel Stücken? Kürzlich hoffte ein Magistrat zuversichtlich. Leser, haben Sie schon ohne Zuversicht und Hoffnung gehofft?
Der Diener ist in der Amtssprache zum Bedienten vorgerückt; folglich müßten die Richter den Betrüger zum Betrogenen umbiegen. Rücksicht ist zu Rücksichtnahme ausgewalzt. Meint man, es töne menschlicher, menschlicher etwa als Rücksichtgabe? Bereiten wir uns vor bald mit Rücksichthabe, Vorsichtsein und Ähnlichem beschenkt zu werden! – Selbst der schwallreichsten Revolverzunge eines amerikanischen Hochdruckverkäufers genügt „Fühlung" (Contact); vermutlich um jede Verwechslung mit Fühlunggabe zu meiden, besteht unser Lautsprecher auf Fühlungnahme. Er nimmt nun fortan Fühlungnahme. „Nun" genügt ihm übrigens nichts mehr, „nunmehr" sagt ihm nunmehr mehr.
In einer Sendung von „Tag zu Tag" hörten wir, wie ein schnellzüngiger Berichter die französische Liedlein-Sängerin X in Kloten begrüßte und fortfuhr: „nun lassen wir die französische Star selbst einige Worte sagen .". – Haben Sie das Wort „spätzeitig" schon vernommen? Wenn nicht, werden Sie es bald hören, denn schon haben wir frühzeitig. Spät genügt noch, früh nicht mehr, obwohl früh an sich ein Zeitbegriff ist und „zeitig" überflüssig macht, besonders wenn man bedenkt, daß die Zeit zeitlos ist.
Eine Ansagerin (Ansagerinnen und Ansager haben zu gehorchen, nicht zu „verbessern“) mußte „... um Berichtgabe an die Polizei" hersagen und das Wetter sei „vielfach sonnig"; auch „den Beruf hat er mehrfach gewechselt ...". Ohne jemand zu fragen, ersetzt man „mal" durch“ -fach". („Das wievielte Fach ist er schön gebüßt worden?" „Das erste Fach"; wievielfach über den Ozean geflogen? „zweifach!".) Ein Ansager mußte durchgeben, es habe sich „verlohnt", ferner „dem Jubilar war es vergönnt", wenn diesem das Schicksal in Wirklichkeit etwas gegönnt hatte (gönnen – Gunst, vergönnen = Mißgunst; in den Mundarten gönnt man einem Menschen einen heiteren Lebensabend, vergönnt oder mißgönnt ihm aber erschlichene Vorteile. Die Mundarten sind im Zweifel oft zuverlässiger als der Duden). Es ist nicht ausgeschlossen, daß, diesem Beispiel folgend, auch der Unterschied zwischen kaufen und verkaufen, heiraten und verheiraten verwischt wird und wir dann nicht mehr wissen, ob es auf das Gleiche herauskommt, ob man jemand heirate oder verheirate. – Man macht kein Hehl mehr daraus, daß das Zeitwort verhehlen am Sterben ist.–
Die Denkfaulheit vieler Verfasser amtlicher Mitteilungen wird unter anderem darin sichtbar, daß heute jeder zweite Satz mit „Nachdem ..." beginnt, selbst wenn „seit", „da" oder „weil" stehen müßte; desgleichen in den ewigen „Verlautbarungen" und in der Unzahl „Rahmen", außerhalb deren auf Erden rundweg nichts geschieht. „Verhältnisse" gehören zum eisernen Bestand eines Berichters; so streikten denn die Postier in Zürich „für bessere Lohnverhältnisse", nicht allein für den Lohn. Verhältnis hat Zustand, Los, Gegend, Umgebung und Umstand beinahe verdrängt, der Einfachheit wegen. Daß die Behörden nicht ruhig sind, wenn wir ihre Gesetze nur achten, ist eindeutig; sie verschaffen Nachachtung, denn doppelt genäht hält besser. Wer hat zu bestimmen, wieviel verschiedene Wörter in einem einzigen Sammelwort aufgehen dürfen? Jene etwa, die nur kraft eigenen Rechts und dank ihrer Stellung ungestraft und laufend Begriffsgrenzen verwischen? –
Es scheint, beim Rundfunk, gleich wie bei Bundes-, Kantons-, Stadt- und Gemeindeämtern, den Polizei- und Heeresverwaltungen, lasse man nur noch Leute zu (mit abgeschlossener Hochschulbildung), die sich zum kindischen und wandelbaren Abklatschallerlei bekennen und allzeit streben, ihre Sprache zu entwerten. Mit Grausen stellt man fest, wie abgenützt und gleichförmig Stil und Wortwahl vieler dieser Stellen sind. Man muß dies zum Teil begreifen, denn ihre Welt beschäftigt sich, gleich dem Obligationenrecht und dem Zivilgesetzbuch, hauptsächlich mit Sachwerten, denen der Mensch Untertan ist.
Die zunehmende Unfähigkeit unserer Funk- und Amtsredner und -Schreiber, sich an feste Begriffe zu halten, merkte jeder, der einen Tag lang am Empfänger säße und alles, was sinn- und stilwidrig ist, niederschriebe, von den Sendungen „zum neuen Tag" (die offensichtlich auf der Annahme beruhen, die Hälfte der Hörer seien Köhler) bis zu den Spätnachrichten. Er müßte zwar ein sehr rascher Schreiber sein! Eine halbe Stunde länger nachgedacht, und wir hätten zum Beispiel keine Mutationen, sondern (militärische) Beförderungen; die wichtige Kunde eines Heerführers hieße nicht mehr Tagesbefehl. Wir hätten auch kein Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA), keine drei Wörter, die im Grunde ein und denselben Begriff ausdrücken. Eine Menge juristischer Sprachzöpfe wären längst abgeschnitten. Wir hätten keine Aktie, weder ein Obligationen-Recht noch ein Zivil-Gesetzbuch, keine Miliz, kein Militär, keine Rekruten und Offiziere und kein Departement. – Eine neue Perle wird nun auch in den Amtsstuben herumgeboten: „ausgelastet". Wissen Sie, was es heißt? Nichts anderes als voll, ausverkauft, voll beschäftigt, ausgenützt, besetzt. Sorgen wir dafür, daß es rasch ausgelachtet wird.
Im privaten Leben findet man der Sprachsünden nicht weniger, seien es geschäftliche oder „schön“geistige. Hier richten sie aber geringeren Schaden an, weil wir nicht verpflichtet sind, Bücher und Anpreisungen zu lesen; über die Sender zu hören bekommen wir sie glücklicherweise noch nicht. Aktien- statt Bier-Brauerei ist weder geistreich noch richtig, ebensowenig der „Timber Room" einer zürcherischen Gaststätte. Vermutlich wurden beide, wie eine Unzahl andrer Geschäftswörter, im Alkoholdunst geboren.
Zu der Oberflächlichkeit in einer Reihe von Amtsstuben reiht sich ein beachtenswerter Mangel an Mut. Daß die Amtssprache gewundener sein muß als der Lauf des Jordens, ist klar, denn die Losung unserer Vormünder und Wegweiser heißt Vorbehalt. Sie bringen somit nicht mehr den Schneid auf, Meinungen zu haben: sie vertreten nur noch welche, auch ihre eigenen. Auch nicht den Mut, andere gute Wörter zu gebrauchen als die „andern", denn man will auf keinen Fall aus der Reihe tanzen. Darum Parks statt Pärke, die Autos statt die Auto, Schutztrupps statt -truppen (Deutsch hat keine Mehrzahlendungen mit s), Endzielsetzung statt Ziel. Darum nie mehr Imbiß, Schnaps und Wirtshaus; der neue Heimatstil verlangt Snack, Cocktail, Restaurant und Bar (meistens gewöhnliche Standbeizen oder Spunten mit minderem Bier als in Fuhrmännerkneipen.
Unsichere und alle, die schneller schwatzen als denken, sollten jede mündliche oder schriftliche Kunde an die Jugend meiden. Ich habe hier im einzelnen wohl nur Kleinigkeiten bemängelt; die Summe dieser Nadelstiche kann jedoch unheilbar verletzen. Die Würger unserer Sprache sind gegen Tadel taub und blind; überdies haben sie keine Zeit, ihn zu lesen oder zu hören. So etwa von Vierzig an lernen die meisten Menschen zu ihrem alten, halb oder ganz vergessenen Kram überhaupt nur ungern anderes, als was ihnen höheren Lohn oder größeres Ansehen verspricht. Zu diesem Behufe ist schwätzen oft wichtiger als reden, sudeln einträglicher als schreiben, verdüstern feinsinniger als klären. Manch einer der durch Ton und Schrift zum Volke drängt, ist ob der Wucht und Blütenreinheit seines eigenen Stils derart verzückt, daß nichts ihn retten kann. Aber selbst der tiefste Gehalt eines Gedankens ist nie so stark, als daß ihm ein Lumpengewand, genannt Schluderdeutsch, nicht schadete. Man denke daran, wieviel die englische Bibel durch die Übersetzung in die Gegenwartssprache an Wucht und Poesie verloren hat; eine schlechte Reportage sei aus ihr geworden, hieß es in einer englischen Zeitung. So darf es nicht weitergehen. Man soll sich aus Bequemlichkeit und Denkfaulheit nicht auf die „Lebendigkeit" und den „unvermeidbaren stetigen Wandel" in der Sprache berufen und so der Sprachleere verfallen.
Ein Sprachgericht mit Wächtern brauchen wir. Kein Amtssatz über die Sender, keiner auf Papier soll uns erreichen, es habe ihn denn ein Wächter gestriegelt. Sprachkenner gibt es genug, besonders unter unverbrauchten Lehrern im Ruhestand; sie bieten auch Gewähr für ruhige Überlegung. „Die Kosten!", werden die Räte und Unterausschüsse händeringend und sorgenfaltig mahnen, denn es geht hier vermeintlich nicht um materielle Gewinne. – Es wird weniger kosten als zwei Handels- oder Militärattaches. – Oder ist etwa mit Dunst und Doppelsinn leichter zu herrschen? W. E.
Mörder unserer Sprache
Autor(en): W.E.
Objekttyp: Article
Zeitschrift: Sprachspiegel : Zweimonatsschrift
Band (Jahr): 17 (1961)
Heft 6
http://doi.org/10.5169/seals-420664
PDF erstellt am: 02.01.2020 ETH-Bibliothek
Zusätzliche Absätze eingefügt! Sa.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 10.01.2019 um 10.31
Das Journal für die reine und angewandte Mathematik, kurz Crelles Journal, ist eine der renommiertesten mathematischen Fachzeitschriften. Es wurde 1826 in Berlin gegründet und ist damit das älteste heute noch existierende Periodikum im Bereich der Mathematik. [Wikipedia]
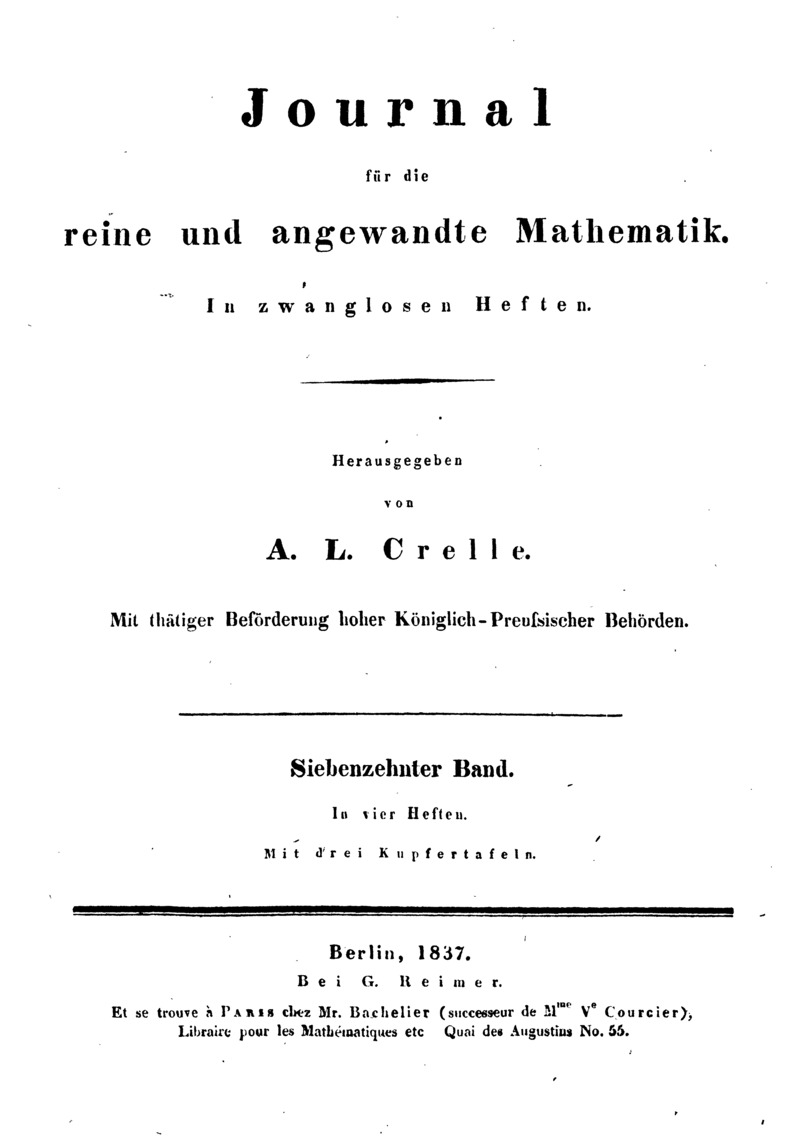
Ein Blick in die ersten Jahrgänge zeigt die damals schon europäisch angelegte Zeitschrift. Die Beiträge wurden auf Latein, Französisch oder Deutsch veröffentlicht. Die Texte sind in Antiqua gedruckt, wobei die deutsche Rechtschreibung Wert auf die Darstellung des ß (in der Form ſs) legte, wie schon in früheren Ausgaben der Literatur. Die Behauptung, daß für die Antiqua 1901/03 erst neue ß-Lettern geschaffen werden mußten, ist Unsinn.
Angenehm ist auch die international gleichbleibende Verwendung des lateinischen „C“ anstelle der eindeutschenden Transkription „K“ und „Z“, deren „Reform“ schon bei Rudolf Virchow keine Gegenliebe fand. Die seltenen, heute antiquiert wirkenden, aber mitunter differenzierenden „th“ anstelle der „t“ („Thau“ gegen „Tau“, Strick) gehörten zum Schmuck des Wortes dazu.
Das Inhaltsverzeichnis des mich gerade interessierenden Bandes 1837 führt u.a. diese Beiträger auf: G. Lejeune Dirichlet (Berlin, frz.), C.G.J. Jacobi (Königsberg in Preuſsen, dt.), E.E.Kummer (Liegnitz, lt.), J.G. Plana (Turin, frz.), J. Steiner (Berlin, dt.)
eingetragen von Sigmar Salzburg am 29.03.2018 um 20.46
Wie das Heft „Pandora“ Nr. 4 von 1946 (Aegis Verlag Ulm, 2,50 RM) in meine Hände gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Das Schwerpunktthema ist „Sprache und Schrift“. Aus einem Artikel von Franz Thierfelder hatte ich hier früher schon zitiert. Kurz der Inhalt: Einleitend ist einiges aus der „Deutschen Grammatik“ von Jakob Grimm vorangestellt. Danach folgt ein Text eines (wohl nicht unbegründet) anonymen Kleinschreibers und weitere normalschriftliche Beiträge:
(anonym) „kampf um den buchstaben“ (S.5); Dr. Dr. Franz Thierfelder „Schönheit des Schriftbildes“; Dr. Wilhelm Hartnacke „Brauchen wir eine neue Rechtschreibung?; Heinrich Fleissig „Entwicklungsgesetz der Schriftׅ“; Wilhelm Dreecken „Von deutscher Rechtschreibung“; Paul Renner „Schrift und Rechtschreibung“; Prof. F. H. Ehmke „Die deutsche Schrift in Gefahr!“; Prof. Dr. F. C. Roedemeyer „Gesprochenen Sprache“; (anonym) „Wunder und Geheimnis der Sprache“Hier gebe ich zwei kurze Ausschnitte aus dem ersten langen Artikel des unbekannten Kleinschreibfundamentalisten wieder. Interessant ist, daß er alle Errungenschaften der 1996er-„Reform“ verschmäht, sogar die Heyse-ß/ss-Regelung. Die waren also eher ein notdürftiger Ersatz für den mißlungenen Kleinschreibputsch, um die Notwendigkeit umfassender „Reformen“ vorzugaukeln:
der kampf um den buchstaben(Korrekturen am abgeschriebenen Text vorbehalten.)
mich schmerzt es tief, daß kein volk unter allen, die mir bekannt sind, seine sprache so barbarisch schreibt wie das deutsche.
jacob grimm.
überall in deutschland ist die erörterung über die zweckmäßigkeit einer reform der deutschen rechtschreibung im gange, wobei es sich in der hauptsache um die frage der verbindlichen einführung der kleinen anfangsbuchstaben handelt. begreiflicherweise hat diese in den kreisen der wissenschaft und der lehrerschaft lautgewordene diskussion sehr schnell auch die aufmerksamkeit der laien erregt, denn die schrift ist ja ein „gebrauchsgegenstand“, mit dem wir alle tagtäglich umgehen. es ist andererseits auch begreiflich, daß so mancher diese gute gelegenheit, seinen witz zu üben, nicht unbenutzt vorübergehen ließ. man rief die Erinnerung an den naturapostel gustav nagel wach, und es lag nahe, die von ihm propagierte kleinschreibung unter dem gleichen Gesichtspunkt zu betrachten wie seine zahlreichen sonstigen eigenbrötlerischen narreteien. auch hat man mit überlegenem achselzucken die frage gestellt, ob wir denn heutzutage keine anderen sorgen hätten als die erörterung von fragen der deutschen rechtschreibung. [1946!]
freilich haben wir größere und vordringlichere sorgen als einen solchen kampf um den buchstaben. aber wer wollte behaupten, daß es deshalb nun notwendig sei, die pflege der güter des geistes und der kultur zurücktreten zu lassen? und wer wollte daran zweifeln, daß zu diesen gütern auch unsere muttersprache zählt? es wird ja nicht verlangt oder erwartet, daß sich nun jeder deutsche mit den grammatischen fragen der sprache beschäftigen soll. im gegenteil! so erfreulich nämlich an sich die ausweitung der aussprache ist, so scheint es doch manchmal, als ob sich allzu viele in dieses gespräch mischen, für dessen ernsthafte erörterung denn doch einige sachkenntnis die unerläßliche voraussetzung ist.
durchaus verfehlt ist jedenfalls der versuch, mit dem hinweis auf gustav nagel die untersuchung auf diesem teilgebiet sprachlicher gestaltungsform in das lächerliche und abstruse zu ziehen. aber kann die tatsache, daß sich auch narren mit einem problem beschäftigen, die ernsthaftigkeit dieses problems in frage stellen? auch tut man jenem einsiedler am arendsee in der altmark wirklich zu viel ehre an, wenn man ihn als den „erfinder“ der kleinschreibung der anfangsbuchstaben der hauptwörter bezeichnet. es gibt vielmehr seit mehr als 100 jahren eine beachtliche gruppe deutscher wissenschaftler, die aus ihrer erkenntnis vom wesen der sprache die verwendung großer buchstaben abgelehnt haben. es möge genügen, auf die tatsache hinzuweisen, daß der altmeister der deutschen sprachforschung, jacob grimm, in allen seinen wissenschaftlichen werken und abhandlungen (besonders auch im deutschen wörterbuch) kleinen anfangsbuchstaben verwendet hat. und wenn die deutschen universitäten für seminararbeiten und dissertationen die kleinschreibung zulassen, so wird man annehmen dürfen, daß dies mit gutem grunde geschieht. auch möge vermerkt sein, daß stefan george und seine jünger sowie das bauhaus dessau die kleinschreibung gepflegt haben. [.....]
S.10
die gegner einer neuordnung der orthographie im sinne der kleinschreibung können allerdings eine ganze anzahl von gründen ins feld führen, von denen nachstehend einige der wichtigsten untersucht seien.
zunächst könnte man anführen, daß auch wir und unsere eltern auf der schule den unterschied zwischen klein und groß begriffen hätten, und daß unsere kinder ja auch nicht viel dümmer seien als wir. außerdem würden unsere vorfahren ihre gründe gehabt haben, wenn sie sich zur großschreibung der hauptwörter entschlossen. hierauf kann man sich eine antwort im grunde ersparen. doch wollen wir an unserer stelle georg christoph lichtenberg, den witzigsten und geistreichsten kopf der deutschen, zu worte kommen lassen: „das haben unsere vorfahren aus gutem grunde so geordnet, und wir stellen es aus gutem grunde nun wieder ab.“ so steht es in seinen aphorismen, und es ist ein überzeugendes argument gegen jeden übertriebenen konservativismus.
weiter kann eingewendet werden daß die schrift beispielsweise der engländer und franzosen eine reform mindestens ebenso nötig hätte wie die deutsche, ohne daß jedoch die royal society oder die akademie française eine neuregelung in angriff genommen hätten. das ist erstens nur zum teil richtig, und zweitens täten wir gut daran, uns zunächst einmal mit unsern eigenen angelegenheiten zu befassen, ehe wir an fremden kritik üben – und sollten wir wahrhaftig des ausländischen vorbilds bedürfen, um die reformbedürftigkeit unserer schrift zu erkennen und ihre mängel abzustellen? die sorgen für die englische und französische schrift dürfen wir ruhig den engländern und franzosen überlassen. außerdem müßten, so behaupten die „gegner“, bei der durchsetzung der neuordnung alle bücher müssen neu gedruckt werden. dies scheint in der tat ein gewichtiger beweisgrund. wollte man ihn jedoch endgültig gelten lassen, so wäre eine reform der schrift überhaupt niemals möglich. im übrigen würde es gar nicht erforderlich sein, alle bücher neu zu drucken, denn auch jener, der gelernt hat, alle hauptwörter klein zu schreiben, wird keine schwierigkeiten haben, ein buch unserer tage zu lesen, ebenso wie wir ohne mühe der lage sind, die besonderheiten in der schreibung unserer väter, großväter und Urgroßväter zu begreifen (Thor statt Tor, sey statt sei usw.). entscheidend ist der geist, nicht die form, in der man ihm dauer zu verleihen sucht.
die oft gehörte behauptung, daß mit der kleinschreibung der anfangsbuchstaben eine erschwerung des verständnisses eintreten würde, ist gleichfalls nicht berechtigt. den beweis möge diese vorliegende abhandlung liefern, sie mag dem leser freilich einen ungewohnten anblick bieten, aber ihre lektüre bereitet gewiß keine besonderen schwierigkeiten.
besonders auffällig ist vielleicht, daß auch hier die satzanfänge, eigennamen usw. klein geschrieben sind. es liegt vom stand der rechtschreibelogik in der tat kein grund vor, anders zu verfahren – und wenn andere völker es anders halten, so ist das kein anlaß für uns, es ihnen unbedingt gleichzutun.
bei der behandlung der frage einer neuordnung der rechtschreibung ist übrigens, was für den laien erstaunlich klingen mag, die frage der kleinschreibung der anfangsbuchstaben der hauptwörter von ziemlich untergeordneter bedeutung. sie ist keine eigentliche streitfrage mehr im wissenschaftlichen sinne, denn ihre sprachlich-logische berechtigung steht fest. es ist eine frage, die jetzt weniger die wissenschaft als vielmehr die praxis zu beschäftigen hat: es handelt sich nicht mehr um die berechtigung, die kleinschreibung einzuführen, sondern nur noch um die frage der zweckmäßigkeit der umstellung des schulunterrichts auf die neue regelung, sowie des zeitpunktes und der mehr oder weniger durchgreifenden art ihrer durchführung...
eingetragen von Sigmar Salzburg am 23.11.2016 um 14.03
Karl Kraus wehrte sich heftig gegen das Weglassen des „h“, so beim „Thau“ in der seit 1901 eingeführten Einheitsschreibung. Reinhard Markner hat nun bei Sprachforschung.org eine wenig bekannte Begründung für den Erhalt bei Adelung ausgegraben, die ich dreist hier einfach abkupfere:
»Th, der Figur nach ein zusammen gesetzter Buchstab, welcher indessen doch nur einen einfachen Laut bezeichnet, einen Laut, welcher dem t gleicht, nur daß er der Regel nach gelinder seyn, und das Mittel zwischen dem weichern d und härtern t halten sollte; Theil, Theer, Thau, Muth, Bethen, Werth.
In den neuern Zeiten hat dieser Buchstab von solchen, welche sich zu Sprachverbesserern aufwarfen, und die Verbesserung der Sprache immer mit der Rechtschreibung anfingen, weil da das Bessern am leichtesten und bequemsten ist, viele Gegner bekommen. Die schwächsten darunter verkannten seinen wahren Werth und seine Bestimmung, und glaubten, daß das h bloß zur Bezeichnung eines gedehnten Selbstlautes da sey, und aus Unkunde in den vorigen Zeiten von seiner rechten Stelle versetzt und dem t angehängt worden.
Unter der Zahl dieser befand sich auch Mosheim, dessen anderweitige Gelehrsamkeit und Verdienste viele auf seine Seite zogen, welche glaubten, ein gelehrter Mann müsse gerade in allen Wissenschaften und Theilen derselben gleich gelehrt seyn. Beyder irrigen Voraussetzungen zu Folge schrieben Mosheim und seine Nachfolger Noht, rahten, Wehrt, Teihl, tuhn, Tiehr, Tuhrm, teuher u. s. f. und glaubten, sich ein großes Verdienst erworben zu haben, daß sie das h ihren Gedanken nach wieder an seine rechte Stelle gebracht hatten.
Allein, es war sehr leicht ihnen zu zeigen, daß das h, wenn es dem t zugesellet wird, kein Zeichen eines gedehnten Selbstlautes, sondern vielmehr eines gelindern Lautes des t sey, und dieses geschahe besonders von Gottsched in den krit. Beytr. Th. 5 S. 571 und in seiner Sprachkunst, ob er gleich keinen andern Grund anzugeben wußte, als weil die Niederdeutschen in den Fällen, wo wir ein th schreiben, ein d gebrauchen; welches aber viel zuviel beweiset, indem auch das härteste t der Hoch- und Oberdeutschen in eben so vielen Fällen im Niederdeutschen ein d ist.
Mit Mosheim sind die Feinde dieses Buchstabens nicht abgestorben, sondern es haben sich auch noch in den neuesten Zeiten verschiedene sogenannte Sprachverbesserer gefunden, welche das h verbannet wissen wollten, weil sie keinen begreiflichen Nutzen von demselben einsahen.«
Originalquelle hier, transkribierte Quelle und weiteres hier.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 07.09.2016 um 02.59
etwas ist einem zu viel; man ärgert sich über etwas; man ist einer Sache überdrüssig; jemand wird wegen etwas (berechtigt) zornig; etwas geht über das erträgliche Maß hinaus
umgangssprachlich, veraltet; Die Hutschnur war früher eine weitverbreitete Halteschnur, die unter dem Kinn hindurchlief und den Hut (insbesondere beim Reiten) auf dem Kopf festhielt. Zur Erklärung der Redensart könnte man daran denken, dass das Bild des Ertrinkens oder Versinkens in einem Sumpf suggeriert werden soll, ähnlich wie in der Redensart "jemandem steht das Wasser bis zum Hals".
Es gibt aber noch eine andere, überraschende Deutung: Im Staatsarchiv zu Eger wird eine Urkunde vom 30. April 1356 aufbewahrt, in der sich die Kreuzbrüder und die Deutschherren über die Nutzung einer Wasserleitung einigen. Die ersten Anlieger an dieser Wasserleitung sollen nicht mehr Wasser entnehmen dürfen, als sie unbedingt brauchen, "und des selben Wazzers schol in niht mer noch diecker auz den Roeren gen, danne ein Hutsnur". Die Hutschnur ist in diesem Dokument also ein Maß für die Dicke eines Wasserstrahls. Wer Wasser in einem Strahl von einem Durchmesser entnahm, der "über die Hutschnur" hinausging, machte sich danach eines Vergehens schuldig
jemandem geht die Hutschnur hoch
umgangssprachlich, selten; Eine so genannte Kontamination: Vermischung der beiden Redensarten "es geht einem etwas über die Hutschnur" und "jemandem geht der Hut hoch". Siehe auch "es geht einem etwas über die Hutschnur"
redensarten-index.de
Nebenbei: Bei diesem Eintrag geht es mir z.B.„über die Hutschnur“, daß es dem Kultusministerpack in Kumpanei mit den Medienmächtigen gelungen ist, die traditionszerstörerischen Heyse-ss gegen den Willen der Sprachgemeinschaft weitgehend durchzusetzen und daß die beflissenen Unterwürfigen dann auch noch die eigentlich wieder zurückgenommene balbutistische Wortspaltung „so genannt“ verwenden.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 25.01.2016 um 19.31
Glosse
Rechtschreibung: Luther, setzen, 6!
Von Matthias Heine Feuilletonredakteur
Wer je Martin Luther im Original gelesen hat – und nicht jenes Werk, das heute als Luther-Bibel firmiert, aber nur noch soviel Luther enthält wie Nüsse im Nutella stecken –, der ahnt, dass die Idee, es gebe so etwas wie eine logische und natürliche Rechtschreibung, eine Wahnvorstellung ist. Es gibt nur Konventionen, und Luther pfiff auf sie, wie fast alle seiner Zeitgenossen. Zunächst.
Luther schrieb nicht nur ganz anders als wir heute. Er schwankte auch in seinen Schreibweisen. Im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums, also der Weihnachtsgeschichte, standen in der ersten Übersetzungsfassung des Neuen Testaments vom September 1522, dem sogenannten September-Testament, dicht nebeneinander zeytt und zeyt oder vnnd neben vnd.
Den Namen seiner Hauptwirkungsstätte Wittenberg schrieb Luther sogar in sage und schreibe 14 verschiedenen Varianten: Wittenbergk, Wittenburgk, Wittenberg, Wittemberg, Wittembergk, Vuittenberg, Viuttemberg, Vuittenbergk, Vuittembergk, Wittemperg, wittenberg, Wyttemberg, Vvittenberg und wittemberg.
Der DDR-Luther-Forscher Erwin Arndt erklärte das 1962 in seinem Buch "Luthers deutsches Sprachschaffen" (in dem man selbstverständlich auch ganz nebenbei erfuhr, wie die sowjetische Sprachwissenschaft und Friedrich Engels Luther beurteilten) so: "Das ist nur dadurch möglich, dass es für Luther und seine Zeitgenossen eine Norm in unserem Sinne überhaupt nicht gegeben hat, sie nach Lage der Dinge auch gar nicht geben konnte. Jeder schrieb, wie er es für gut und richtig befand."
Hinzu kam beim Reformator eine gewissen Lust an der expressiven Schreibweise und dem Sprachspiel. Luther, so Arndt, habe anscheinend – wenigstens in seinen ersten deutschen Schriften – sogar "eine heimliche Freude daran gehabt, ein und dasselbe Wort mit verschiedenen Buchstaben zu schreiben."
Das Schreibchaos der Zeit beschrieb Luthers Korrektor Christoph Walther: "Wenn hundert Briefe und gleich mehr und gleich mehr mit einerlei Wörter geschrieben wörden, so wörde doch keiner mit dem Buchstaben übereinstimmen, daß einer mit Buchstaben geschrieben wörde wie der andere."
Doch es waren Leute wie Walther, die Luther allmählich eine einheitliche Rechtschreibung abverlangten und beibrachten. Vor der ersten Bibelübersetzung 1522 kümmerte sich Luther kaum um Fragen der Rechtschreibung und des Schriftbildes. Die Wittenberger Druckerei von Hans Lufft, für die Walter arbeitete, hatte aber ein Interesse daran, die Luther-Bibeln überregional zu verkaufen. Also verbesserten und vereinheitlichten die Drucker Luthers Orthografie und reinigten sie von mitteldeutschen Regionalismen.
Nachdem Luther bemerkt hatte, dass durch solche Eingriffe sowie durch Nachlässigkeit und Flüchtigkeit der Drucker oft seine Texte entstellt wurden, begann er, auch der äußerlichen Seite der Sprache mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Seit Mitte der 1520er-Jahre mussten Bücher nach seinen Grundsätzen gedruckt werden. Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass er selber Korrektur gelesen hat.
Nun bemühte er sich, in Übereinstimmung mit den Druckereien, selbst zunehmend um die Vereinheitlichung seiner Rechtschreibung: Konsonantenhäufungen wie bei zeytt, die typisch für den frühneuhochdeutschen Wildwuchs waren, wurden seltener. Er schrieb immer seltener tzehen oder czehen, sondern fast nur noch zehen.
Auch die 14 unterschiedlichen Schreibweisen für Wittenberg kommen nur in Luthers ersten Schriften bis zum Jahre 1523 vor. Arndt berichtetet: 1524 nutzte er nur noch sechs verschiedene Schreibweisen, 1535 nur noch vier, 1539 drei und ab 1542 endlich nur noch zwei, nämlich Wittemberg und Vuittenberg, wobei jedoch die erste Form schon seit 1524 bei weitem überwog. Der Siegeszug der Reformation war auch der Tatsache geschuldet, dass Luther seine epochenbedingte Dyslexie überwand.
welt.de 25.1.2016
Der Artikel soll wohl mit dem heutigen, von den Kultusministern herbeigeführten Schreibchaos versöhnen: „Früher war alles viel schlimmer!“ – W und Vu sind sicher nicht als zwei Schreibweisen gemeint, sondern das zweite ist aus zwei Lettern zusammengesetzt (double u), wie man sich auch ab und zu mit ſs statt ß behalf, wenn das andere nicht greifbar war.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 16.07.2015 um 07.46
Aus der Vorrede
... so darf ich auch meine Arbeit der freien Beurtheilung mit der Erwartung preis geben, daß man auch Gutes darin finde, die Mängel aber mir auf eine Art sagen werde, welche belehren und bessern kann. Ohne das erste zu hoffen, würde ich das Buch nicht geschrieben haben, am letztern aber zweifeln, wäre Beleidigung für das Publikum...
... Man muß in der That etwas Patriotismuß haben, und den trockenen grammaticalischen Untersuchungen Geschmack abgewinnen können, wenn man sich durch alle damit verbundenen Schwierigkeiten hindurch arbeiten will...
Ueber meine Arbeit darf ich nicht weiter urtheilen. Ich habe mir Mühe gegeben, den Grund der Sprache in ihr selbst zu suchen und aus ihrer Natur, so viel ich konnte, deutliche Begriffe zu entwickeln. Man wird es der Arbeit wohl ansehen, durch welche Männer ich mich habe leiten lassen; Die dahin gehörigen neuern Schriften der Herren Adelung, Moritz, Meinatz, Heynatz, Purmann und Jacon Harris durfte und mußte ich dabei zu Rathe ziehen. Bei der ganzen Arbeit ist es mir am allerwenigsten um Neuerung und Sonderbarkeit zu thun gewesen; seit dem ich über die Sprache mehr nachgedacht habe, ist mir der Sinn dazu vergangen. Nur den einen Umstand rechne man mir dazu nicht an, daß ich mich des Gebrauchs des y ganz enthalte. Wenn ich gleich glaube, ja gewiß wissen könnte, daß das y in Zukunft noch ganz werde verstoßen werden, so wird man mir doch den Vorwurf machen, daß ich es als Sprachlehrer zu früh thue und nicht vorgreifen sollte. Gern hätte ich auch diese Gewohnheit wenigstens in diesem Buche abgelegt, wenn sie nicht so sehr alt und mir so natürlich geworden wäre, daß ich mich tausendmahl dabei zu vergessen fürchten mußte. Zerbst, den 9. April 1790.
Aus Johann Ernst Stutz „Deutsche Sprachlehre“ Potsdam 1790
books.google.de
Kursivierung hinzugefügt: Vergleiche die heutige „neue“ Größtschreibung.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 19.07.2012 um 06.13
Hat mir meine Tochter vom letzten Flohmarkt mitgebracht:
Gottfried Benn, Briefwechsel mit Paul Hindemith [u.a.],
Fischer TB 5466 1986
Es geht um die Entstehung des Oratoriums „Das Unaufhörliche“ (1930):
BENN AN [den Philosophen] EWALD WASMUTH
[Berlin] 17 XII 31.
Lieber Herr Wasmuth, ich flehe Sie direkt um etwas an: bitte schreiben Sie mir nur per Schreibmaschine. Ich kann Ihre Schrift nicht lesen, bei studenlangem Starren u. Studieren mit Lupe und Beleuchtungseffekten entziffere ich sie nicht. So schade! Hätte mich so sehr interessiert, was Sie zu der Aufführung sagten! …
Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=HU2i0yRdJDY
eingetragen von Sigmar Salzburg am 15.07.2012 um 21.40
Versuch einer Chronik von Eckernförde
Von C. G. Hansſen, Kiel, Gedruckt in der Königl. Schulbuchdruckerei 1833
[76 S., 8°]
Ueber der Stadt am beseegelten Busen der Ostsee,
Nahe der fruchtbaren Flur, wo der dänische Pflüger den Deutschen,
Dieser den Dänen versteht, dem gesegneten Erbe der Angeln,
Kränzet den Bord, der des Meeres einst höhere Fluthen zurückzwang,
Dunkles Gehölz und schauert dem Wandrer Grauen der Vorzeit.
Joh. Heinr. Voß
Inhalt
Vorwort
Erster Abschnitt. Geschichte der Stadt
I. Sagenzeit (vor 1416)
...
XI. Eckernförde seit 1801
… Sechster Abschnitt. Das Christianspflegehaus
Verzeichniß der Abonnenten [S.VII-XIV]
[vorgeheftet] Druckfehler.
S. 6, Z.8 v.o nach Cappelle ein Komma ...
" 11 " 3 v.u. nach Stadt ein Komma ...
" 14 " 4 v.o. nach 26) ein Semicolon ...
...
Vorwort
...
Erster Abschnitt
Geschichte der Stadt
I. Sagenzeit ...
3) Die Burg
... Besonders spricht dafür, daß eine Burg wirklich in dieser Gegend bestanden habe, der Name des zum Theil auf dem noch jetzt vorhandenen Rest des Ballastberges gelegenen Dorfes Borbye, welcher bei der weichen Aussprache, wie aller dänischen Buchstaben, so auch das g, offenbar aus dem Dänischen: Borgbye d.i. Dorf der Burg entstanden ist ...
Sechster Abschnitt
Das Christianspflegehaus
Oberdirector: S. Durchlaucht der Landgraf Carl von Hessen. 1767 –
Directoren: Major C.H. v. Meleys. 1790 Obristlt. 1785-95 …
Directionsmitglieder: 1stes D. Major v. Muderpach 1820 …
Commission zur Verbreitung des wechselseitigen Unterrichts: Captain v. Krohn 1820 …
Schullehrer: [11 Pers.]
Musiklehrer: Lorenzen 1796-1812; Präscher 1812-1820; Mehder 1820.-
Regimentschirurgen: 1785-1820, geb. 1751 zu Nedelba: Er machte zuerst, zwölf Jahre vor Jenner, auf die Wirkung der Kuhpocken aufmerksam; …
Rechtschreibung allgemein:
zu Stande gekommen; aufs Neue; eine adlige Dame, Namens Clara; auf das Härteste; Schifffahrt; in baar; Gränze
sogenannte; Zeitlang; vor kurzem; insonderheit
eingetragen von Sigmar Salzburg am 15.05.2012 um 07.43
Walter Boehlich ( 1921 - 2006 )
Literaturkritiker, Übersetzer und Herausgeber
Aus irgendeinem Grund weigerte sich Boehlich, die ß-Taste seiner Maschine zu betätigen, und so verwendete er in Vorwegnahme der Rechtschreibreform an den entsprechenden Stellen immer ein Doppel-s.
Titanic 6/2006
Familienarchiv Boehlich, Mappe Wolfgang Boehlich, Lebenserinnerungen. Die Vermeidung des „ß“ war in der Familie nicht unüblich. Sie lässt sich auch in Briefen von Edith Boehlich nachweisen. Bei Walter Boehlich wird sie programmatisch. Er benutzt in seinen Manuskripten meist „ss“, auch wenn es in den Veröffentlichungen herausredigiert wurde. Anlässlich der Reform der deutschen Rechtschreibung fordert er, dass „grundsätzlich, wie in der Schweiz, das nicht in die lateinische Schrift gehörende und unnütz verwirrende ß abzuschaffen“ sei.
Walter Boehlich: Reform der Vernunft? Die „kleine Reform“ der Rechtschreibung; halbe Lösungen und komplette Idiotien. In Titanic 17 (1995) H. 1, S. 20-23, hier S. 23.
[Walter Boelich: Kritiker, Hg. Helmut Peitsch, Helen Thein-Peitsch; Fußnote 38, S. 29]
Ein verbreiteter Irrtum. Dagegen spricht die Geschichte der Typographie, z.B.:

Christoph Plantin, Antwerpen 1570
eingetragen von Sigmar Salzburg am 24.11.2010 um 13.37
Lieber Russell!
Dank Dir vielmals für Deinen lieben Brief. Ehrlich gestanden: es freut mich, daß mein Zeug [Tractatus] gedruckt wird. Wenn auch der Ostwald ein Erzscharlatan ist! … Ich traue dem Ostwald zu, daß er die Arbeit nach seinem Geschmack, etwa nach seiner blödsinnigen Orthographie, verändert.
Ludwig Wittgenstein an Bertrand Russel 28. November 1921
[Cambridge letters: correspondence with Russell, Keynes …]
eingetragen von Sigmar Salzburg am 18.10.2010 um 15.43
Klaus Achenbach
trug bei Sprachforschung.org folgendes Fundstück ein:
Zufällig stieß ich auf das "forwort" aus den Populären Schriften von Ludwig Boltzmann (1905):
ich musste mir in meinen lezten büchern di neue ortografi
gefallen lassen, di zu erlernen ich zu alt bin; so
möge man sich hir im forworte di neueste ortografi gefallen
lassen. ich glaube, man soll di abweichungen fon
der fonetik, wenn man si nicht ganz ferschonen will, dann
schon alle hinrichten. wenn man dem hunde den schwanz
nicht lassen will, schneide man in mit einem griffe ganz ab!
sprachforschung.org 18.10.2010
P.S.: Ich sehe gerade, daß ich das Zitat schon vor sechs Jahren hier eingetragen habe.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 01.08.2010 um 16.04
Robert Walser „Poetenleben“ Genf und Hamburg 1967.
Im Nachwort des Herausgebers:
Walser hatte auch eigene Vorstellungen über die zu wählende Schrift. Als ihm der Verlag eine Satzprobe vorlegte, antwortete er, er «sei der Meinung, daß sich für das Seelandbuch, dessen Charakter vorwiegend naturhaft ist, Fraktur besser eigne wie Antiqua. Nur ungern würde ich in die mir freundlich eingesandte Druckart einwilligen, die mir nicht sonderlich gefallen will, da sie mir zu hart erscheint. Fraktur hat immer etwas Warmes, Rundliches, Gutherziges. Ich möchte sie daher für meine Schriften bevorzugen … »
(26.10.1918 an den Rascher Verlag, Zürich).
[Walser konnte sich nicht durchsetzen.]
eingetragen von Sigmar Salzburg am 31.05.2010 um 20.02
In meiner Sammlung fand ich ein Heft „Pandora“ von 1946 (Aegis Verlag Ulm), Schwerpunktthema „Sprache und Schrift“. Den darin enthaltenen gegensätzlichen Standpunkten ist einleitend einiges aus der „Deutschen Grammatik“ von Jakob Grimm vorangestellt. Danach folgt auf einen Text in Kleinschreibung ohne Verfasserangabe – in Fraktur gedruckt – Thierfelders „Schönheit des Schriftbildes – Eine Verteidigung der Großbuchstaben“. Er kommt aber sehr schnell auf sein Hauptanliegen, nämlich die Einleitung einer Rechtschreibreform, die sich nahtlos an die gescheiterte Rustsche Reform angeschlossen hätte. Die Ähnlichkeiten mit dem Ablauf fünfzig Jahre später sind auffällig, manche Unterlassungen verhängnisvoll. Anscheinend ist ihm aber nie der Gedanke gekommen, daß man mit der vorhandenen Rechtschreibung auch noch einige Jahrhunderte gut leben könnte:
… An sich ist der Zeitpunkt, in dem die Reform mit einem Minimum an Kosten durchgeführt werden könnte, gekommen; ein bedeutender Teil unseres nationalen Schrifttums, gerade auch des älteren, muß neu gedruckt werden, und ein erschreckend hoher Prozentsatz unserer Bücher wurde durch den Krieg vernichtet. Empfohlen werden kann die Reform jedoch nur dann, wenn sie nicht nur in allen Zonen Deutschlands, sondern auch in den Gebieten jenseits unserer Grenzen eingeführt wird. Die Sprache ist vielleicht das wichtigste einigende Band, das uns nach der Katastrophe geblieben ist, das Symbol, an dem wir uns untereinander noch erkennen, das einzige auch, das wie in früherer Zeit unser geistiges Leben mit der außerdeutschen Welt verknüpft. Wir müssen ernstlich prüfen, ob wir heute schon innerlich soweit gesammelt sind, daß wir die orthographische Erneuerung objektiv und maßvoll durchführen können. Die früheren erregten Aussprachen in Aufsätzen, Broschüren und Diskussionen haben gezeigt, daß sich viele zu Wort melden, die unsachliche Nebenabsichten verfolgen; es wäre zu bedauern, wenn die Reform der Rechtschreibung als neuer Erisapfel in unser gespaltenes, noch immer tief beunruhigtes Volk geworfen würde.
Wem auch immer die Reform zur Durchführung anvertraut werden sollte, der darf eins nicht vergessen: jeder Radikalismus macht den gewünschten Erfolg unmöglich, weil er Teile der deutschen Sprachgemeinschaft mit Sicherheit veranlaßt, ablehnend beiseite zu treten. Die Festsetzung einer Rechtschreibung ist nie ein Akt gewesen, der für „die nächsten tausend Jahre“ gilt; wie sich die Sprache unaufhaltsam, bald langsamer, bald schneller wandelt, so auch die Schreibweise, und es gibt mancherlei Änderungsbedürftiges, was man zweckmäßig erst auf der nächsten Konferenz erledigen wird. Denn jederzeit weist die Sprache eine Menge von Fällen auf, in denen der Gebrauch schwankend geworden ist, ohne daß man bereits klar sieht, nach welcher Seite sich das Sprachbedürfnis der Volksmehrheit endgültig entscheiden wird. Ein Entschluß, der heute noch heftigen Widerspruch und damit unnötigen Kostenaufwand bewirken würde, ist morgen vielleicht des allgemeinen Beifalls sicher. Auch ist aus technischen Gründen die stufenartige Anpassung der Schreibung an die Sprachentwicklung zu empfehlen; zwar entsteht niemals „endgültig“ Ruhe, nach der die Geistesträgen so sehr verlangt, dafür wird der Sprung von einer Reform zur anderen nicht so groß, daß zwischen dem bisher gültigen und dem neu zu druckenden Schrifttum eine schwerüberbrückbare Kluft entsteht. Es wäre zu prüfen, ob nicht etwa aller [!] dreißig Jahre eine Rechtschreibreform stattfinden sollte; in der dazwischen liegenden Zeit wäre von einer dazu berufenen Stelle das Material zu sammeln, das die Konferenz zu begutachten hätte.
Welche Stelle freilich ist dazu berufen? Die Frage ist heute schwerer zu beantworten als früher, da es deutsche Zentralinstanzen verschiedenster Art gab, die das Recht der sprachlichen Betreuung glaubten für sich in Anspruch nehmen zu können. […] Wo ein solches Sprachamt am zweckmäßigsten zu errichten wäre, soll hier nicht erörtert werden; dagegen darf man sich sehr wohl schon jetzt Gedanken über seine mögliche Zusammensetzung machen, denn von ihr hängt der Erfolg einer Reform nicht zuletzt ab.
Sprachpflege ist nicht, wie man bei uns lange geglaubt hat, eine Beschäftigung für Musestunden [!] sprachbeflissener Dilletanten [!]; ebensowenig aber ist sie ausschließlich Angelegenheit der Sprachgelehrten. Die praktische Bedeutung und Anwendung der Sprache im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben ist so groß geworden, daß in vielen Fällen philologische Gesichtspunkte allein nicht mehr entscheidend sind. Zwar wird der Fachgermanist nach wie vor als Berater bei allen orthographischen Überlegungen und Entscheidungen unentbehrlich sein, nicht weniger aber wird man des Journalisten, des Rundfunks, des Verlegers, des Dichters, des Buchdruckers, des Verwaltungsbeamten, des Industriellen und nicht zuletzt des Sprachlehrers und Pädagogen bedürfen. Die Aufzählung will nicht vollständig sein; es werden sich noch andere Gruppen melden und ihr besonderes Interesse an der Rechtschreibreform bekunden. Denn tatsächlich handelt es sich hier um eine der wirklich allgemeinen Volksangelegenheiten, die den Greis wie den Schüler, den Minister wie seine schlichteste Schreibhilfe betreffen. Ein ständiger Ausschuß für Fragen der Rechtschreibung wäre also auf breiter demokratischer Grundlage zu bilden, in dem die strittigen Fragen der Orthographie geklärt werden müßten. Ist in Deutschland wieder ein Sprachamt vorhanden, dann würde dieser Ausschuß einen Teil von ihm bilden. Zunächst aber könnte er auch ganz für sich bestehen, denn allein durch sein Vorhandensein ließen sich unerwünschte Sonderverfahren mit ziemlicher Sicherheit vermeiden. Ich erinnere daran, daß sich bereits voriges Jahr Lehrertreffen in Mittel- und Norddeutschland für radikale Eingriffe in die gegenwärtige Rechtschreibung ausgesprochen haben; was damals Absicht blieb, könnte morgen rasch verwirklicht werden.
Über die Organisation einer sprachpflegerischen Zentralstelle mögen die entscheiden, die dazu berufen werden; hier soll nur eine Forderung vertreten werden, die in Deutschland nicht laut genug erhoben werden kann: die Sprachpflege ist zwar eine Angelegenheit behördlichen Interesses, nicht aber behördlicher Betätigung. Wenn die Sprachpflege nicht von dem freien Willen der geistig interessierten Schichten einer Nation getragen wird, dann ist es besser, die Sprache dem Wildwuchs zu überlassen, der nie so viel verderben kann wie eine seelenlose Verwaltung.
Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was vom Standpunkt vorsichtigen Bewahrens zur Rechtschreibreform zu sagen ist: die Erneuerung ist notwendig, sie sollte bald geschehen, gleichzeitig aber auf eine Grundlage gestellt werden, die die organische Fortentwicklung der Schreibung in Zukunft gewährleistet. An der Reform ist das ganze Volk interessiert und dementsprechend zu beteiligen. Da unsere Muttersprache das Fundament unseres Daseins in geistiger Hinsicht bildet und in ihrer Wirkung über die politischen Grenzen hinausreicht, darf die Reform erst dann durchgeführt werden, wenn die Anerkennung ihrer Ergebnisse im ganzen deutschen Sprachbereich gesichert ist.
Franz Thierfelder (1896 -1963) deutscher Publizist, Sprachwissenschaftler und Kulturpolitiker.
In der biographischen Notiz zu Thierfelder heißt es im vorliegenden Heft zu seiner vorhergehenden Tätigkeit nur: Seit 1926 war er, zuletzt als Generalsekretär, an der deutschen Akademie. Als diese nach 1933 politisiert wurde, schied er aus.
Wikipedia erwähnt: 1926 wurde er Pressereferent, 1930 Generalsekretär der Akademie zur Wissenschaftlichen Erforschung und Pflege des Deutschtums (Deutsche Akademie) in München, die er in den nächsten Jahren schwerpunktmäßig auf „Sprachförderung im Ausland“ ausrichtete. Angesichts des wachsenden politischen Einflusses der Nationalsozialisten unternahm der konservative Thierfelder „karrierebedingte Anpassungsleistungen“. [mit Beispielen]
eingetragen von Sigmar Salzburg am 21.05.2010 um 04.28
Wohlen sie leb, sunden sie geschlaf!
Als die Bildungsbürger im achtzehnten Jahrhundert Hochdeutsch lernten, war auch der Aufsteiger Leopold Mozart dabei. Der Vater des Musikgenies trieb seiner Familie die Mundart aus - das war kein Zuckerl nit.
Von Wolfgang Krischke
13. Mai 2010
Leopold Mozart war nicht nur Komponist und Musikpädagoge, sondern auch Sprachkritiker. Wolfgangs Frau Constanze fürchtete, ihr Schwiegervater würde sie „über ihre orthographie und Concept auslachen“, und zögerte deshalb, ihm überhaupt zu schreiben. Den Verleger, der seine „Violinschule“ herausbrachte, belehrte Leopold, wann es zweyte oder zwote heißen musste, er verordnete ihm das Dativ-e (dem Tacte), diskutierte über erforderet oder erfordert und verlangte, ereignen durch eräugen zu ersetzen, weil sich das Wort von „Auge“ herleitet.
Leopold, der Deutschmeister der Familie, richtete sich nach den grammatischen Regeln, die der Leipziger Professor Johann Christoph Gottsched dekretierte. …
[Das erinnert an die Pedanterie der Schreibreformer, die das Wort „behende“ nach tausendjähriger Trennung gewaltsam wieder an die „Hände“ anbinden wollen.]
Gottscheds Normen waren das Destillat einer jahrhundertelangen Entwicklung, zu der das Bibeldeutsch Luthers und die Schreibpraxis der politisch einflussreichen sächsischen Kanzleien wesentlich beigetragen hatten. …
Auch Wolfgang streute in seine Jugendbriefe noch mundartliche Wendungen ein (kein zuckerl nit). Seit seinen Reisen nach Mannheim und Paris 1777 aber orientierte er sich wie der Vater am Gottschedschen Hochdeutsch, das für ihn auch eine Befreiung von der provinziellen Enge Salzburgs symbolisierte.
Aber als begnadeter Wortjongleur legte er die Mundart nicht einfach ab, sondern machte sie ebenso wie fremdsprachliche Wendungen, Jargonausdrücke oder das gestelzte Kanzleideutsch zum Material seiner Sprachspiele: „Est-ce que vous avez compris? redma dafia Soisburgarisch den es is gschaida.“ Lange vor Dada und den Experimenten der konkreten Poesie demontierte Mozart die Grammatik und komponierte mit ihren Formen bis dahin nicht gehörte Sätze: „Wohlen sie leb, sunden sie geschlaf!“
faz.net 13.5.2010
(„Sprachvariation im achtzehnten Jahrhundert. Die Briefe der Familie Mozart“, in: Zeitschrift für Germanistische Linguistik, Heft 37.1 und 37.2, 2009).
Anmerkungen: Mozarts Sprachspiele, besonders in seinen bekannten derben Bäsle-Briefen, machen ein wenig sichtbar, wie sein Geist schöpferisch arbeitete: Hundertfache Variationen eines Themas sind gleichzeitig präsent oder werden in schneller Folge erfunden. Im Musikalischen konnte er dann die beste Version fehlerlos aufzuschreiben.
[Mannheim 5.11.1777] Allerliebstes bäsle häsle! Ich habe dero mir so werthes schreiben richtig erhalten falten, und daraus ersehen drehen, daß der H: vetter retter, die fr: baaß has, und sie wie, recht wohl sind hind; …
Alle Briefe Mozarts zeigen den lebendigen Gebrauch des „ß“, wie er seit vierhundert Jahren üblich war und noch weitere 200 Jahre andauerte, bis die bekannte Kultusbanausen-Mafia den Würgegriff ansetzte. Die folgenden Zitate stammen aus dem Inseltaschenbuch 128, in dem sinnvoll die Briefe in Fraktur gedruckt sind, so daß auch die Unterscheidung der s-Längen erkennbar bleibt.
Wien, den 16.Juny 1787
Liebste Schwester! Daß Du mir den traurigen und ganz unvermutheten Todesfall unseres liebsten Vaters nicht selbst berichtet hast, fiel mir gar nicht auf …
[Wien, März 1790 …an Puchberg] Hier schicke ich Ihnen, liebster Freund, Händels Leben. – Als ich letzhin von Ihnen nach Hause kam, fand ich beyliegendes Billet von B. Swieten. Sie werden so wie ich daraus sehen, daß ich nunmehro mehr Hoffnung habe als allzeit.
[Aus dieser Biographie hatte ich hier schon zitiert. Mozart nahm also Anteil am Wirken anderer großer Musiker.]
Parigi li 30 di giuglio 1778. [An Aloysia Weber] Carißimia Amica! La prego di pardonarmi che manco questa volta d’inviare le variazioni per l'aria mandatami – ma stimai tanto neceßario il rispondere al più presto alla lettera del suo sig: Padre, …
[Man sieht, daß das „ß“ auch im Italienischen noch gebräuchlich war.]
[26. Nov. 1777, Nachschrift des Elfjährigen in einem Brief der Mutter]
Nun muß ich schlieſſen weil ich keinen Plaz mehr habe zum schreiben …
eingetragen von Sigmar Salzburg am 08.12.2009 um 10.30
„Alle Religionen seind gleich und guht, wan nuhr die leute, so sie profesieren, erliche Leute seindt; und wen türken und heiden kähmen und wolten das land pöblieren, so wollen wier sie Mosqeen und Kirchen bauen.“ So weit Friedrich der Große von Preußen, der von Orthografie wenig, von Liberalität dafür mehr verstand als mancher Heutige.
welt.de 5.12.09
eingetragen von Sigmar Salzburg am 29.09.2009 um 07.59
Zu den deutschen Texten des 19. Jahrhunderts, die in Antiqua erschienen, aber das „ß“ in der damals üblichen Form darstellten, zählen auch die Erstausgaben der Abhandlungen von Wilhelm von Humboldt:
Indem ich die gegenwärtige Schrift dem Publicum übergebe, wünschte ich vorzüglich, daß sie dazu dienen möge, andere Untersuchungen über die Urbevölkerung des ganzen westlichen und südlichen Europa daran anzuschließen. In den bisherigen bleibt unläugbar noch Vieles ungewiß und dunkel.
Wilhelm von Humboldt
„Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der Vaskischen Sprache“ Berlin 1821
Indem die Sprachen nun also in dem von allem Mißverständniß befreiten Sinne des Worts Schöpfungen der Nationen sind, bleiben sie doch Selbstschöpfungen der Individuen, indem sie sich nur in jedem Einzelnen, in ihm aber nur so erzeugen können, daß jeder das Verständniß aller voraussetzt und alle dieser Erwartung genügen.
Wilhelm von Humboldt
„Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus“ Berlin 1836
Später übernahm man statt des ineinandergeschobenen, unverbundenen Buchstabenpaars aus Lang- und Rund-s das originale „ß“ aus dem italienischen Renaissance-Alphabet. Das war aber auch im Deutschland des 16. Jhdts. nicht unbekannt, wenngleich zusammenhängende deutsche Texte immer in Fraktur gedruckt wurden. Einschübe in anderen Sprachen erschienen dann wieder in Antiqua.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 20.09.2009 um 08.49
Ich lese gerade im Faksimile: „Dr. Karl Burney’s Nachricht von Georg Friedrich Händel’s Lebensumständen … Aus dem Englischen übersetzt von Johann Joachim Eschenburg, Professor in Braunschweig“ Berlin und Stettin 1785.
Nachfolgend einige damals (bis heute) übliche Schreibweisen, die jetzt nach zweihundert Jahren von den Kultusministern verboten wurden oder sinnlos zum Abschuß freigegeben:
… nicht eher, als bis ein berühmter Mann schon eine Zeitlang verstorben ist, fangen die Nachforschungen und Vermuthungen an. (III)
„Ich weiß gewiß, sagt Mattheson, wenn er dieses liest, wird er im Herzen lachen; denn äußerlich lacht er wenig. Insonderheit, falls er sich des Taubenkrämers erinnert, der mit uns damals auf der Post nach Lübeck fuhr…“ (X)
Er blieb eine Zeitlang zu Florenz, wo er die Oper Rodrigo verfertigte.(XVI)
Bei dem Kardinal Ottoboni, bey dem Händel sich sehr in Gunst setzte, hatte er zum öfteren Gelegenheit, den naturvollen, sanft fühlenden Corelli seine eigenen Stücke spielen zu hören. (XVI)
[Der Sänger Janson verfehlte die richtigen Töne] … so arg, daß Händel ihn aufs derbste anfuhr, in vier bis fünf Sprachen fluchte, und zuletzt in gebrochenem Englisch ausrief: „Du Schuft du, sagtest du nicht, du könntest vom Blatt wegsingen“? – „Ja, Herr Kapellmeister, sagte Janson, das kann ich auch; aber nicht gleich das erstemal.“ (XVI)
An einem Abend … hatte [Orchesterleiter] Dubourg eine Solostimme zu einer Arie zu spielen, und eine Cadenz ad libitum zu machen. Er irrte in verschiedenen Tonarten eine Zeitlang umher [und als er endlich beim Schlußtriller zurückfand, rief Händel zur Belustigung der Zuhörer:] „Willkommen zu Hause, Herr Dubourg!“ (XXXVII)
Er war zufahrend, rauh und entscheidend in seinem Umgange und Betragen; aber ohne alle Bösartigkeit und Tücke. (XLI)
Bey aller Rauhigkeit seiner Ausdrücke aber, und bey aller seiner Fertigkeit im Fluchen, welches damals mehr, als itzt, Mode war, verdient Händel doch das Lob eines redlichen und frommen Mannes. (XLIII)
Sonntags Abend fand er gewöhnlich den Schauspieler Quin in ihrem Hause, der, seiner natürlichen Rauhigkeit ungeachtet, ein großer Liebhaber der Musik war. Mrs. Cibber bat Händel’n gleich das erstemal, als Quin da war, sich ans Klavier zu setzen; und ich erinnere mich, daß er die Ouvertüre zum Siroe spielte, und uns alle durch die außerordentliche Nettigkeit entzückte, womit er die Gique am Schluß derselben spielte.(XLII)
In manchen Stük-ken …. (S.23)
[Fußnote des Übersetzers zu „Apostel“:] In unserem Tedeum heißen sie Zwölfboten, eine vor und zu Luthers Zeiten gewöhnliche Benennung der Apostel, die man nicht getrennt in zwey Worten schreiben sollte. E. [vergl. „Hohepriester“, reformiert: „Hohe Priester“] (S.24)
Eine gefällige wohlklingende Stimme … (S.42)
[Beim Erklingen der auf der Naturtrompete nicht rein spielbaren Quarte] … sah man Mißvergnügen auf jedem Gesichte, welches mir ungemein leid that, … (S.69)
eingetragen von Sigmar Salzburg am 23.05.2009 um 07.54
In einer Glosse des ORF v. 12. Mai 2009 behauptet ein Marc Carnal, „genießen“ käme von „niesen“ und seit der Rechtschreibreform schriebe man „genießen“ mit „ß“. Beides ist natürlich völliger Unsinn:
Erst im Rahmen der Rechtschreibreform schreibt man 'genießen' mit sz*.
* Ich möchte an dieser Stelle der Süddeutschen Zeitung den Slogan
"Genießen – mit SZ"
zum Vorzugspreis anbieten
http://fm4.orf.at/stories/1602830/
Selbstverständlich sind seine unterleiblich betonten Anmerkungen in „neuer“ Großkotzschreibung verfaßt:
Schon die Idee eines Kitzels auf meinen glücklicherweise recht empfindlichen Schleimhäuten lässt mich meine Hände reiben, die ich mir selbstverständlich im Beisein Anderer beim geglückten Atemswegs-Cumshot vor die Nase halte.
Das einzig Interessante an dem Text ist darin das Zitat aus Konrad von Megenbergs „Buch der Natur“ von etwa 1350:
Diu nase ist ain sidel der smeckenden kraft der sêl, die derkent ainen smach vor dem andern. der nasen nutz ist auch, daz der mensch den âtem zeuht durch die nasen und daz er dâ mit niest und sich saubert von der wüestigkait des hirns. daz niesen geschiht von dem, daz sich in der luft wegt in dem hirn und die fäuhten auztreibt. ez ist auch ain unverschrôten weg des auswendigen lufts mit dem inwendigen nâtürleichen luft, der beslozzen in den behenden âdern, die entspringent in dem herzen und gênt auf in daz hirn. Dû scholt auch wizzen, daz des smackes sidel ist oben in der nasen …
So fern uns zeitlich dieser Text steht, gibt es doch in der Rechtschreibung auch beachtenswerte Konstanten.
Dem Schreiber des Textes ist das „ä“ durchaus bekannt, aber er denkt nicht daran, „auswändig“ „inwändig“ oder „behände“ zu schreiben. Erst 650 Jahre später fiel es unseren Schulpolitikern ein, per Erlaßdiktatur das letztere mit „e“ für strafbewehrt falsch zu erklären.
Die dem Süddeutschen nahestehende Schreibung „ain“ statt „ein“ wäre auch dem heutigen Hochdeutsch angemessener. Der Vereinheitlichungswahn der „Reformer“ wollte jedoch noch 1973 das „ai“ völlig aus der Rechtschreibung auszuschließen („Ein hei vorm bot des weisen keisers.“)
Die durchgängige Kleinschreibung des Mittelalters wurde zum Vorbild für Jakob Grimm, in dessen Nachfolge viele Germanisten auf den Reformzug der linken Bilderstürmer von 1968 aufsprangen, die das gleiche Ziel verfolgten. Daß nun das genaue Gegenteil als „die Reform“ verkauft wird, zählt zu den vielen Dreistigkeiten dieser Falschmünzertruppe.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 19.02.2008 um 06.17
Gottfried Keller an Conrad Ferdinand Meyer
Hottingen 26 X 82
Verehrter Herr!
Indem ich Ihnen herzlich für Ihr schönes Geschenk danke, begrüße ich zugleich das glückliche Ereigniß; denn ein solches darf man und dürfen wir Alle das Erscheinen Ihrer Gedichte nennen. Obgleich es unverschämt scheint, dem, der das Verdienst hat, Glück zu wünschen, so thue ich dies dennoch, da es auch für das Verdienst ein schönes Glück ist, vollständig ausreifen zu können. […]
Mit einiger Schadenfreude hab' ich in Ihren Gedichten bereits bemerkt, daß die neue Orthographie in Ansehung des Th im Druck in die Brüche gegangen ist. Ich habe das gleiche Schicksal mit einer neuen Auflage der Zürch. Novellen, in der das arme h zum Teil exstirpirt, zum Theil stehen geblieben ist.
Ihr bestens grüßender
u ergebener
G. Keller
eingetragen von gestur am 22.06.2004 um 20.13
geb. 1844, gest. 1906, kinetische Gastheorie, Entropie, Boltzmann-Gleichung, Boltzmann-Konstante
Physiker haben es besser: Sie machen Experimente und / oder theoretische Überlegungen und leiten daraus Formeln ab. Eine Formel sagt mehr als viele Seiten Text. Verstehen brauchen sie nur Physiker und Physik-Studenten.
eingetragen von Sigmar Salzburg am 22.06.2004 um 14.36
Vorhin im Zeitforum eingetragen von:
CarstenH - 22. Jun 2004 15:17 (#1887 of 1887)
Das Leben ist bunt…
forwort
ich musste mir in meinen lezten büchern di neue ortografi gefallen lassen, di zu erlernen ich zu alt bin; so möge man sich hir im forworte di neueste ortografi gefallen lassen. ich glaube, man soll di abweichungen fon der fonetik, wenn man si nicht ganz ferschonen will, dann schon alle hinrichten. wenn man dem hunde den schwanz nicht lassen will, schneide man in mit einem griffe ganz ab!
Wien, den 8. Juni 1905. Ludwig Boltzmann
__________________
Sigmar Salzburg
eingetragen von Reinhard Markner am 16.06.2004 um 13.07
"In der gesprochenen Sprache [. . .] gibt es Grade der Angemessenheit wie : 'Sehr üblich' -- 'üblich' -- 'weniger üblich' -- 'unüblich'. In der Rechtschreibung gibt es dagegen nur ein 'falsch' oder 'richtig'."
Gerhard Augst : "Rechtschreibreform vor der Entscheidung ?", in : Muttersprache 93 (1983), S. 95
eingetragen von Sigmar Salzburg am 10.04.2004 um 12.00
Rechtschreibung
[längerer Artikel]
…J. Grimm wirkte auf die R. insofern keineswegs günstig ein, als er durch die Betonung der Abstammung der Wörter, überhaupt des historischen Standpunktes in der R. die mühsam errungene Einheit wieder gefährdete….
[Laufende Änderung der Rechtschreibung]
…Ungeachtet dieser Opposition hat sich doch durch die Macht der Schule und des Buchdrucks die neue R. rasch in weitesten Kreisen Bahn gebrochen, und es ist kaum zu bezweifeln, daß die nächste Generation nur nach der neuen R. schreiben wird. Doch ist der Wunsch wohl allgemein, die baldige Wiederholung einer derartigen Reform vermieden zu sehen.
__________________
Sigmar Salzburg
eingetragen von Walter Lachenmann am 06.12.2003 um 20.30
Über die deutsche Rechtschreibung klagte schon Jakob Grimm 1847: „Mich schmerzt es tief, gefunden zu haben, daß kein Volk unter allen, die mir bekannt sind, heute seine Sprache so barbarisch schreibt, wie das deutsche.“ Mit starker Übertreibung, denn sinnloser als die deutsche ist die französische und gar die englische gewiß. Grimm meinte wohl nur die damalige Regellosigkeit, nicht den Grad des Abweichens der Schrift vom Laut. Durch zwei amtliche „Orthographiereformen“ ist jetzt wenigstens der Zustand geschaffen, daß man „richtig“ schreiben kann, wenn man will, das heißt wenn man sich nach den amtlichen Beschlüssen und den entsprechenden Wörterverzeichnissen richtet. Daß unsre Klassiker und ihre Zeitgenossen meist sehr schwankend und nach heutigen Begriffen sehr unrichtig schrieben, ist bekannt. Beim Freiherrn von Stein komm vor „Crayß“ statt „Kreis“. Sicherlich hat sich die deutsche Rechtschreibung im Vergleich mit der des 18. Jahrhunderts wesentlich gebessert; schon die endlich errungene Einheitlichkeit ist ein Segen, selbst wenn dabei manches Unbegreifliche untergelaufen ist, so namentlich das ieren. Rechtschreiberische Eigenbröteleien in deutschen Wörtern sind nicht zu dulden, allenfalls mit Ausnahme solcher Fälle, in denen durch groß- und klein-Schreiben (Alle, alle) Mißverständnissen vorgebeugt werden kann. Von den Fremdwörtern dagegen soll es heißen: Schreibt zu, dies Wort ist vogelfrei! Je lächerlicher man sie schreibt, desto eher werden sie verschwinden; es ist ein Ärgernis, daß die Verfasser unsrer Wörterbücher der Rechtschreibung Tausende von Fremdwörtern mitaufnehmen. Ich habe nichts gegen axeptieren, echstirpieren, Milljöh, Nüankße, Fong, Fotöllch, Detalch, Ankßangbel, zumal da diese Schreibungen die Aussprache der meisten Fremdwortfreunde getreu wiedergeben.
Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, 1918
__________________
Walter Lachenmann
eingetragen von Sigmar Salzburg am 17.04.2003 um 11.04
Germania,
Lesebuch für die oberen Klassen
evangelischer Schulen
von Karl F. Theodor Schneider
Schleswig 1877
Verlag von B. Meves & Co.
241 Aufsätze und Gedichte allgemeinbildender literarischer, biblischer, geschichtlicher, naturwissenschaftlicher und vaterländischer Art von unterschiedlichen Autoren, sogar einer über die Entdeckung und Berechnung der Geschwindigkeit des Lichts.
Prosa ist in Fraktur gedruckt, Poesie in Antiqua. Das ß besteht aus einem Lang-s mit eng folgendem Rund-s; das lange s wird, anders als in älteren Drucken, in der Antiqua nicht mehr verwendet.
Ein Blick auf die sonstige Rechtschreibung zeigt, wie berechtigt es ist, die „neue" Rechtschreibung in Anführungszeichen zu setzen.
Vorwort.
Meiner Fibel mit dem Lesebuche für die Unterstufe, welche zuerst im Jahre 1864, und meinem Kinderfreunde, welcher zuerst 1873 erschien, lasse ich nunmehr das Lesebuch für die oberen Klassen gehobener Volksschulen folgen.
Ueber die Grundsätze, nach denen ein Lesebuch zu entwerfen ist, habe ich mich des Näheren in der Vorrede zu meinem Kinderfreunde geäußert, und es freut mich, daß dieselben von verschiedenen Seiten her Anerkennung gefunden. ...
In Betreff der Anordnung des Stoffes, die ich durchaus nicht für gleichgiltig ansehe, habe ich im Ganzen und Großen der geschichtlichen den Vorrang einräumen zu müssen geglaubt. Meine Germania ist, wie schon ihr Titel besagt, für evangelische Schulen berechnet; aber zu gleicher Zeit habe ich mich redlich bemüht, auch den Nichtevangelischen gegenüber unnöthigen Anstoß zu vermeiden. Und so wünsche ich denn, daß mein Buch in den Schulen, für die es bestimmt ist, unter der Leitung tüchtiger Lehrer dem Unterricht in der Muttersprache, in der Geschichte, wie in den Realien eine geeignete Grundlage darbieten, und zugleich hinüberleiten möge zu der selbstständigen Lectüre unserer deutschen Meister in Prosa und Poesie. ....
Schleswig, den 17. December 1876.
K. F. Th. Schneider
24. Arion
...
An wohlerworbnen Gaben
wie werd’ ich einst mich laben,
des weiten Ruhmes froh bewußt!" –
...
er hat nicht allzuviel den Wogen,
den Menschen allzuviel vertraut.
...
So trägt der Sänger mit Entzücken
das menschenliebend sinn’ge Thier.
A. W. v. Schlegel
...
230. Schleswig-Holsteins geographische Lage und Bevölkerung
...
Wenn ein Theil auf den Anbau des meist fruchtbaren Landes eine lohnende Thätigkeit verwandte, so gab einem andern Schifffahrt und Handel eine Beschäftigung, die den Blick erweiterte, und oft zugleich reichen Ertrag gewährte.
232. Der Uebergang nach Alsen.
Am 26. Juni 1864 lief die Waffenruhe ab. Am 29. wurde Alsen genommen. ... „Solange man von Alsen sprechen wird, wird dieser Uebergang als ein tollkühnes Unternehmen gelten. Vielleicht barg diese Kühnheit das Geheimniß des Erfolges. ... Was sich wehrte, wurde niedergemacht, Andere gefangen genommen. Noch Andere wichen der Fohlenkoppel zu, wir hinterdrein, – ..." Der Uebergang nach Alsen ist eine glänzend-rasche That gleich dem Düppelsturm. ... Noch drei Wochen lang währte der Krieg: der Limfjord wurde überschritten, die friesische Inselgruppe erobert; was aber in Wahrheit den Frieden dictirt, den Kopenhagener Trotz gebrochen hatte, das war der Alsentag.
Nach Fontane
N.B.: Als Teilnehmer erhielt auch mein Urgroßvater das „Alsenkreuz" – und 140 Jahre später ist trotz UNO Krieg immer noch ein Mittel der Politik.
__________________
Sigmar Salzburg
eingetragen von Reinhard Markner am 07.01.2003 um 12.15
Christian Garve
Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, 1. Theil, Breslau 1792
»Der größte Vortheil, der durch [die Rechtschreibung] zu erhalten steht, muß von der, bey den guten Schriftstellern der Nation, bewirkten Gleichförmigkeit derselben herkommen. Nun ist aber in Dingen, welche die Vernunft, auf eine ganz einleuchtende und allgemein geltende Weise, aus Gründen nicht entscheiden kann, Uebereinstimmung der Menschen anders nicht möglich, als wenn sie sich freywillig einer Autorität unterwerfen, deren Aussprüchen sie auch dann folgen, wenn sie sie nicht durchaus billigen. Weil ich nun in Deutschland keinen | Mann kenne, der in Sachen der Sprache einen gegründetern Anspruch auf Autorität hätte, als Adlung [!]: so habe ich, jenem Grundsatze zu Folge, in den Fällen, wo ich zweifelhaft war, seine Vorschriften zu Rathe gezogen, und selbst da, wo er mich nicht überzeugte, ihm, aus Liebe zum gemeinen Besten, freywillig gehorcht. Ich wünschte, daß mein Beyspiel, oder diese meine Gründe von einem größern Gewicht wären, als ich natürlicher Weise erwarten kann, um die guten Schriftsteller Deutschlands zu einer ähnlichen Nachgiebigkeit zu vereinigen. Ich sehe wenigstens keinen andern Weg, zur Gleichförmigkeit in unserer Rechtschreibung, -- die doch immer ein wünschenswerthes Gut ist, weil sie die Verständlichkeit befördert, und die Störungen der Aufmerksamkeit für gewöhnliche Leser vermindert, -- zu gelangen, als daß alle, welche schreiben, in Fällen, wo bisher Verschiedenheiten der Ortographie [!] geherrscht haben, willkührliche Entscheidungen, die ihnen niemand als Gesetze | aufzudringen vermag, durch freywillige Befolgung zu Gesetzen zu erheben ; und daß sie einem Manne, der in Absicht vieler Sachen ihr Lehrer gewesen ist, in einigen auch blindlings folgen.« (S. XVII-XIX)
eingetragen von Reinhard Markner am 18.07.2002 um 21.04
Hermann Hesse an einen Korrektor, Oktober 1946
Sehr geehrter, lieber Herr Korrektor
Da wir beide immer wieder aufeinander angewiesen sein und gemeinsame Arbeit zu leisten haben werden, kann es vielleicht nichts schaden, wenn ich einmal für eine Stunde von den beständigen kleinen Korrekturen, Zurechtweisungen und Erziehungsversuchen, die wir beide einer am andern zu üben gewohnt sind, absehe, und Ihnen etwas Prinzipielles über Ihre und meine Arbeit, das heißt über meine Vorstellung vom Sinn dieser Arbeit, von ihrer Funktion im Ganzen des Volkes, der Sprache, der Kultur zu sagen versuche. Sie wissen, daß es gut und freundlich gemeint ist, und werden mir dies auch dort, wo Sie meine Auffassung keineswegs teilen, zugestehen. [. . .]
Die gemeinsame Arbeit zwischen Autor und Korrektor beginnt ja erst dann, wenn der Autor seine größte und eigentliche Arbeit, das Schreiben seines Buches, längst getan hat. Eben darum neigt gelegentlich der Korrektor dazu, die ganze noch übrige Aufgabe, nämlich aus dem geschriebenen Manuskript ein gedrucktes Buch zu machen, einzig für seine eigene Aufgabe zu halten, von welcher der Autor möglichst ausgeschlossen werden müsse. [. . .] Es scheint ganz einfach zu sein. Der Autor hat seine Arbeit geleistet, man hat sie ihm abgenommen, mag er sich nun Ruhe gönnen, bis ein neues Manuskript seine Kräfte fordert! Warum soll er sich nun auch noch um den weiteren Prozeß der Buchwerdung kümmern, sich in Arbeiten mischen, die den Fachleuten zustehen? Das mag in manchen Fällen ja notwendig sein und als Ausnahme zugestanden werden, namentlich wenn der Autor noch jung und unerfahren ist und erst beim Anblick der vom Setzer überreichten Korrekturabzüge an manche Verbesserungen seines Textes zu denken beginnt, die ein Mann mit Erfahrung eben schon vor der Ablieferung des Manuskriptes in Ordnung bringt.
Völlig unnötig aber, so scheint es vielen und scheint es auch Ihnen, geschätzter Mitarbeiter, ist eine Einmischung des Verfassers in die Arbeit des Korrektors, sobald es sich gar nicht um das Drucken des Manuskriptes, sondern um den Neudruck eines älteren, schon seit Jahr und Tag gedruckt vorliegenden Buches handelt. [. . .] Sofern ich, der Autor, nicht eine Neubearbeitung dieser Texte unternehmen, sondern sie einfach in der frühern Gestalt neu gedruckt sehen will, sollte das doch wirklich ohne mich geschehen können und lediglich eine ziemlich mechanische Arbeit des Setzers und des Korrektors sein.
Ja, so sollte man denken. Und doch ist es nicht so. Wenn ich darauf verzichte, die Korrektur selbst mitzulesen und jeden Buchstaben des Textes genau zu prüfen, dann entsteht unter des Setzers und Ihren Händen ein Text, der zwar bei ganz oberflächlicher Prüfung der alte zu sein scheint, in Wirklichkeit aber vom Urtext in Dutzenden, nein in Hunderten von Kleinigkeiten abweicht.
Wenn in meinem Text etwa steht «Er öffnete die Türe weit . . .», dann haben Sie [. . .] aus der «Türe» eine «Tür» gemacht. Und damit haben wir schon einen der häufigsten Fälle jener Veränderungen genannt, die mein Text unter Ihrer und des Setzers Hand erleidet, eine jener hundert Stellen, die Sie verbessert zu haben glauben, während ich der Meinung bin, sie sei nicht verbessert, sondern verdorben worden. Es geht immer nur um scheinbar Winziges, um einen oder zwei Buchstaben [. . .]. Ich schrieb «Miethaus», und Sie machen «Mietshaus» daraus, ich schrieb «unsrem», und Sie drucken «unserem», und so fort, lauter winzige Kleinigkeiten, aber sie gehen in die Hunderte.
Wenn nun jemand Sie fragen würde, ob Sie wirklich und ernstlich daran glauben, der deutschen Sprache mächtiger und sicherer zu sein als Ihr Autor, so würden Sie ohne Zweifel diesen Gedanken weit von sich weisen. Sie würden sagen, eine solche Selbsteinschätzung liege Ihnen ebenso fern wie eine Geringschätzung des Dichters und seiner sprachlichen Potenz. Aber dichten sei dichten und drucken sei drucken, und es gebe nun einmal eine Norm und eine Konvenienz für Schreibweise und Interpunktion, und wenn der Dichter je nach seiner augenblicklichen Laune ein «e» oder «s» oder ein Komma setze oder weglasse, wenn er selber das einemal «heut», das andremal aber «heute», das einemal bei der gleichen Stelle in einem Satzbau ein Komma, das andremal einen Strichpunkt setze, dann sehe man ja, daß der Dichter selber seiner Zeichensetzung durchaus nicht so sicher sei, und es sei gut, wenn ein Korrektor darüber wache, daß diese äußerlichen Formen und Ausdrucksmittel einheitlich angewendet würden.
Und nun zitieren Sie, lieber Herr Korrektor, Ihren Hausheiligen und Ihr Gesetzbuch, den Duden.
Es kann nun sein, daß ich in mancher Einzelheit dem Duden Unrecht tue, das heißt daß ich bei ihm hier und dort eine Starrheit und Härte mehr vermute, als er wirklich enthält, ich kann das nicht kontrollieren, denn ich besitze keinen Duden und habe nie einen besessen. Nicht weil ich etwa eine Abneigung gegen Wörterbücher hätte, ich besitze ihrer manche, und eines von ihnen, das große Grimmsche Wörterbuch der deutschen Sprache, gehört zu meinen Lieblingsbüchern.
Ich bin auch nicht dagegen, daß es so etwas wie einen Duden gebe, eine Vorschrift für die Rechtschreibung und eine allgemeine Anweisung für den Gebrauch der Interpunktionen. In Zeitaltern, in denen alle schreiben und die meisten schlecht schreiben, sind solche Hilfsmittel durchaus notwendig und willkommen. Was ich gegen den Duden habe, ist nichts Prinzipielles; es ist gut und richtig, daß ein gewissenhafter Schullehrer seinem Volk bei Rechtschreibung und Interpunktion durch Ratschläge behilflich sei. Aber Duden, das wissen Sie ja, ist längst kein Ratgeber mehr, sondern ein unter einem scheußlichen Gewaltstaat allmächtig gewordener Gesetzgeber, eine Instanz, gegen die es keine Berufung gibt, ein Popanz und Gott der eisernen Regeln, der möglichst vollkommenen Normierung.
Vielleicht gibt auch Duden zu, daß man sowohl heut wie heute, sowohl Tür wie Türe, sowohl Miethaus wie Mietshaus sagen könne, ich weiß es nicht. Sie können es ja nachschlagen. Ich weiß nur, daß Ihre Setzer und Sie mir nicht erlauben wollen, von dieser herrlichen Möglichkeit Gebrauch zu machen und, je nach Bedarf, bald heut bald heute, bald hieher bald hierher, bald unsre bald unsere zu sagen. Dies ist es, wogegen ich mich wehre und wehren muß, denn es geht hier um Dinge, für welche es keinen Duden und keine staatliche oder berufliche Autorität gibt, und für die der Dichter und Schriftsteller allein die Verantwortung trägt.
Ob ich sage: «Schließ die Tür» oder, «Schließe die Türe», das ändert am Sinn des Satzes nichts. Es ändert aber anderes. Es ändert -- Sie brauchen den Satz nur laut zu sprechen -- den Rhythmus und die Melodie des Satzes vollkommen. Die beiden weggelassenen Buchstaben machen aus ihm etwas ganz und gar anderes, nicht was den sachlichen Inhalt angeht, den der Satz ausdrückt, sondern in bezug auf seine Musik. Und die Musik, und zwar ganz besonders die Musik der Prosa, ist eines der wenigen wahrhaft magischen, wahrhaft zauberischen Mittel, über welche auch heute noch die Dichtung verfügt. Diese winzigen Silben, hinzugefügt oder weggelassen, nötigenfalls unterstützt durch die Interpunktion, haben eine rein dichterische, vielmehr eine rein musikalische Funktion und Bedeutung. [. . .]
Und nun, wenn Sie mir bis hierher freundlich gefolgt sind; folgen Sie mir noch einen kleinen Schritt weiter. Stellen Sie sich bitte einen Augenblick lang vor, Sie wären Korrektor nicht in einer Druckerei für Literatur, sondern in einer Notendruckerei für musikalische Werke. Als Vorlage für den Druck hätten Sie irgend eine Partitur, einen Klavierauszug oder sonst ein Werk, sei es in der Handschrift des Komponisten, sei es in einem älteren Druck. Als Mitarbeiter hätten Sie den Notenstecher, und mit ihm gemeinsam hätten Sie als Wegweiser und Richtschnur einen musikalischen Duden, das Buch eines musikalischen Schullehrers also, das über die Gesetze und Mittel des musikalischen Ausdrucks, soweit er sich in Notenbildern wiedergeben läßt, Bescheid gibt, dessen Autor ein guter Kenner der musikalischen Sprache, jedoch kein Schöpfer und vielleicht auch kein wirklicher Freund und Versteher der musikalischen Meister ist. Sein Buch hätte die Aufgabe, Leuten als Berater zu dienen, welche Musik schreiben wollen, ohne die Gesetze, Gewohnheiten und Handwerksregeln dieser Tätigkeit ganz zu beherrschen. Das Fatale an diesem wohlgemeinten und sehr nützlichen Buche wäre nur, daß es in einem an Gehorsam gewöhnten Volk durch staatliche Autorität als unbedingt maßgebend eingeführt wäre.
Mit Ihrem nach seinem Musik-Duden gedrillten Notenstecher würden Sie nun also den Druck eines Notenwerkes beginnen. Sie würden verfahren, wie Sie beim Korrigieren einer Roman-Korrektur zu verfahren gelernt haben. Sie würden also im großen ganzen auf treue Wiedergabe der Vorlage, zugleich aber doch auf eine gewisse Beaufsichtigung und Normierung der Notenschrift bedacht sein.
Sie würden sich zum Beispiel niemals erlauben, einen ganzen Takt wegzulassen, wohl aber da und dort eine Viertel oder Achtel- oder Sechzehntelnote, oder Sie würden wenigstens da und dort, wo der Komponist Ihnen zu willkürlich vom Schema abzuweichen scheint, aus zwei Achteln ein Viertel machen, ein passend scheinendes Accelerando-Zeichen einfügen, ein unpassend scheinendes weglassen. Es wären lauter winzig kleine, von Duden erlaubte, ja gebotene Eingriffe, aber sie würden das Musikstück ganz erheblich vergewaltigen. Und in zehn oder zwanzig Jahren würde ein anderer Notendrucker dieses Stück nach Ihrer Version wieder neu abdrucken, vom Setzer wieder mit neuen, winzigen Eingriffen nach einem neuesten, revidierten Duden versehen. Dann würde eine dritte, vierte, zehnte. Neuausgabe dieses Musikstückes ungefähr so aussehen, wie ein großer Teil der wohlfeilen Klassikerausgaben unsrer Dichter in der Zeit vor der Wiederentdeckung des Verleger- und Herausgeber-Gewissens ausgesehen hat.
Ich erschrecke, Verehrter, über den Umfang; den das Briefchen, das ich Ihnen hätte schreiben wollen; mir Linier den Händen angenommen hat. Je älter ich werde, desto schwerer fällt mir das Schreiben, und je schwerer das Schreiben mir fällt, desto mehr Atem und Raum brauche ich, um über die unendlichen Möglichkeiten zu Mißverständnissen hinweg dennoch etwas wie Eindeutigkeit und Gültigkeit des Geschriebenen zu erreichen. Aber vielleicht war es nicht vergeblich; vielleicht träumen Sie nun des Nachts einmal von weggestrichenen Buchstaben, so wie ein Feldherr vielleicht gelegentlich einmal von gefallenen Soldaten träumt. Sie tun ihm dann vielleicht plötzlich leid, und vielleicht fragt er sich, ob ihr Opfer eigentlich wirklich unvermeidbar war.
eingetragen von Walter Lachenmann am 27.02.2002 um 15.35
Der Eine hat eine falsche Rechtschreibung und der Andere eine rechte Falschschreibung.
(Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799)
Von demselben stammt auch der Satz:
»Es gibt eine wahre und eine förmliche Orthographie«,
aber was ist damit wohl gemeint?
__________________
Walter Lachenmann
eingetragen von Reinhard Markner am 18.02.2002 um 18.36
"Buchstaben sind ja keine Laute, sondern Schriftzeichen, und es ist also gut, wenn man auf den ersten Blick erkennt, was das Zeichen bedeutet [. . .]" -- "Man kann es unsern periodischen Schriftstellern nicht oft genug zurufen : Gebt uns doch neue Ideen, und keine neue Orthographie !"
"Ueber die Orthographie in der Berliner Monaths-Schrift. Aus einem Briefe", in : Litteratur- und Theater-Zeitung (Berlin) Bd. 3/1784, S. 58-60
eingetragen von Reinhard Markner am 31.12.2001 um 13.58
»Wenn die Abstammung die Schreibart bestimmen soll, so kann es 1. nur die nächste, 2. die erweislich wahre, und 3. die allgemein bekannte thun, weil nur diese die allgemeine Verständlichkeit, die vornehmste Absicht der Sprache, befördern kann. [. . .] Unverzeihlich aber sind alle im Schreiben vorgenommenen Veränderungen, wenn sie sich auf sehr entfernte, ungewisse oder gar willkührliche und unbegründete Ableitungen stützen, wie ämsig für emsig von Ameise usw.«
Adelung : Deutsche Sprachlehre für die Schulen, 3. Aufl. 1795
eingetragen von Reinhard Markner am 26.12.2001 um 09.32
Der Neffe Grünhage fuhr mit dem seltsamen Wunsche des Greises heraus; aber die Tante Sophie zuckte weder die Achseln, wie er doch ein wenig erwartet hatte, noch lachte sie gar oder sagte wenigstens: das sieht dem alten Kinde ähnlich. Sie sagte einfach und ruhig:
»Das mußte er freilich auf dem Rathause und bei den Stadtverordneten anbringen. Dazu kann er leider die Erlaubnis nicht bei mir sich holen. Ja, das ist wahrhaftig ein Wunsch, den er noch auf dem Herzen haben konnte; und was mich anbetrifft, so tute ich da wahrlich mit ihm in ein Horn.«
»Ich habe auf dem Rathause nicht über den Meister Marten gelacht oder nur gelächelt; aber du wirst mir zugeben, liebe Tante -«
»Gar nichts gebe ich dir zu; und zu bedanken habe ich mich auch nicht, weil du so gut gewesen bist, über meinen besten Freund und den verständigsten Menschen in Wanza dich nicht zu mokieren.«
»Liebste, beste Tante, ich versichere --«
»Da sehe ich ihn stehen vor den beiden jungen neumodischen, gelehrten, ästhetischen Herren, wie er nicht mit der Sprache herauskam und doch so vieles für sich zu sagen hätte. Kind, Kind, ich will euch gewiß nicht das Recht nehmen, in den Tagen zu leben, wie sie jetzt sind, und auf sie zu schwören; aber manchmal meine ich doch, ein wenig mehr Rücksicht auf das Alte könntet ihr auch nehmen. Ich bin nur ein ungelehrtes altes Weib, wenn ich auch überflüssige Zeit gehabt habe, mich mit vielen Dingen zu beschäftigen, an die sonst wir Frauen nicht denken; -- eines habe ich jedenfalls gelernt, nämlich mit jedem Menschen möglichst aus seinem Verständnis heraus zu sprechen; und das will ich auch mit dir tun, mein lieber Sohn. Du bist ein Schulmeister oder willst einer werden und kommst mir also hier grade recht. Mit dem Dorsten ist in keiner Weise bei solchen Fragen etwas anzufangen, dem hilft höchstens nur noch eine gute, verständige Frau für sein eigen Leben in der Welt; und wer weiß, vielleicht wäre nach dem, was du mir von ihr erzählt hast, deine Schwester Käthe so 'ne Frau für ihn. Doch davon ist jetzt nicht die Rede, sondern von Martens Wanzaer Tuthorn, das ein hochweiser Magistrat aus ästhetischen Gründen nicht mehr anhören konnte und gradeso für uns altes Volk den Naseweis spielte wie zum Exempel ihr Schulmeister jetzo mit der deutschen Muttersprache. Da lese ich fast alle Woche einmal davon in den Blättern, wie die in Orthographie oder Rechtschreibung, oder wie ihr es nennt, verbessert werden muß; und in Potsdam haben sie sogar einen Verein gebildet, der die i-Tüpfel abschaffen will. Lehren schreibt ihr ja jetzt wohl ohne h und Liebe ohne e und tut euch auf den Fortschritt, wie der Bürgermeister sagt, riesig was zugute. Ja freilich, Riesen seid ihr; aber ein paar in der alten Weise gedruckte Bände von Schiller und Goethe werdet ihr doch übriglassen müssen, und in denen lesen wir Alten dann weiter. Es ist mir lieb, daß du nicht lachst, mein Junge. Wenn ich auch nur ein ungelehrtes Frauenzimmer bin, so habe ich in meinem Leben Zeit gehabt, über allerhand Sachen nachzudenken, und dein verstorbener Onkel mit seinem ewigen Hohn und Lachen über unsere einheimischen Dummheiten ist mir auch ein guter Lehrmeister gewesen. Es mag an andern Orten vielleicht besser sein, aber hier in Wanza ist jedesmal, wenn von Geschmackssachen die Rede gewesen ist, grade das Gegenteil herausgekommen und die Welt nur noch ein bißchen nüchterner geworden. Das Nachtwächterhorn hatte aber nicht bloß hier in Wanza, sondern in jedwedem Orte in Deutschland einen guten, treuherzigen Klang. Dafür haben sie nun dem Marten Marten eine schrille Pfeife eingehändigt, um darauf seinen Kummer und die Stunden auszupfeifen. Freilich, freilich, viel richtiger und ästhetischer ist das und mit eurer neuen Orthographie und deutschen Sprachverbesserung ganz im Einklang. Ich bin nur eine alte Frau und kann mich also täuschen; aber -- Kind, Kind, scheinen tut es mir doch so, als ob die Welt von Tag zu Tag schriller würde und ihr es gar nicht abwarten könntet, bis ihr sie auf dem Markt, in den Straßen und auf dem Papier am schrillsten gemacht habt. Bist du wirklich schon satt, Bernhard?«
Er war gesättigt! Diesem jungen Philologen und angehenden deutschen Schulmeister war gottlob fürs erste der Appetit gestillt, und zwar nicht allein durch den über alles Lob erhabenen Wanzaer Kalbsbraten nebst Zubehör, den ihm seine Tante Grünhage vorgesetzt hatte. O, sie war wahrlich eine Musikantentochter, die Tante Sophie, und hatte auch die Tafelmusik nicht fehlen lassen.
Viel erregter, als das der Verdauung zuträglich sein soll, sprang der junge Gast vom Stuhle auf und rief in heller Begeisterung:
»Ich gebe dir nochmals mein Wort, Tante Sophie, ich habe nicht über den Meister Marten und seinen Herzenswunsch gelacht, und Dorsten hat's eigentlich auch nicht zustande gebracht. Im Gegenteil! -- Und du hast mir aus der Seele gesprochen! Ja, die Welt wird schriller von Tag zu Tag. Das Horn des Meisters Marten Marten haben sie abgeschafft, weil es ihnen viel zu sonor durch die Nacht klang, und aus der deutschen Sprache streichen sie nicht nur hier und da das h oder sonst einen Konsonanten, nein, am liebsten rissen sie ihr jeglichen Vokal aus dem Leibe, um nur den durcheinanderklappernden Klempnerladen, wozu sie doch schon Anlage genug hat, aus ihr fertigzumachen. Wie Johann Balhorn und nach ihm der Kandidat Jobs verbessern sie das Abc-Buch, indem sie dem biedern, ehrlichen Hahn davor die Sporen nehmen, aber ihm ein Nest mit einem von ihren faulen Eiern unter den Schwanz schieben. Und die heutigen Ohnewitzer scheinen sich das wirklich gefallen zu lassen.«
eingetragen von Manfred Riebe am 24.08.2001 um 17.48
Arthur Schopenhauer (1788-1860) schrieb sein Hauptwerk "Die Welt als Wille und Vorstellung" im Jahre 1818. Das ist im Hinblick auf seine Schreibweise interessant, z.B. seines "th".
Heute könnte man mit Schopenhauer sagen, die Rechtschreibreformer werden, "wenn ihnen nicht die Grammatiker auf die Finger schlagen", die Sprache um wertvolle Wörter "bestehlen". Eine Parallele ergibt sich auch bei den Journalisten:
"Am unverschämtesten treiben es die Zeitungsschreiber (...) so droht durch sie der Sprache große Gefahr; daher ich ernstlich anrathe, sie einer orthographischen Censur zu unterwerfen, oder sie für jedes ungebräuchliche, oder verstümmelte Wort eine Strafe bezahlen zu lassen: denn was könnte unwürdiger seyn, als daß Sprachumwandelungen vom allerniedrigsten Zweig der Litteratur ausgiengen? Die Sprache, zumal eine relative Ursprache, wie die Deutsche, ist das köstlichste Erbtheil der Nation und dabei ein überaus komplicirtes, leicht zu verderbendes und nicht wieder herzustellendes Kunstwerk. (...) Zu beklagen ist es, daß keine Deutsche Akademie da ist, dem litterarischen Sanskülottismus gegenüber die Sprache in ihren Schutz zu nehmen, zumal in einer Zeit, wo auch die der alten Sprachen Unkundigen es wagen dürfen, die Presse zu beschäftigen."
"litterarischer Sanskülottismus" = Unwesen proletarischer Sprachrevolutionäre
Ich bin auch der Meinung, daß die Grammatiker und nicht irgendwelche selbsternannten Sprachverhunzer wie die Rechtschreibreformer oder gar der allgemeine Sprachgebrauch der Journalisten die Sprachmaßstäbe setzen sollen.
eingetragen von Reinhard Markner am 24.08.2001 um 10.24
Ferner will ich hier die Gelegenheit nehmen, das Unwesen zu rügen, welches seit einigen Jahren, auf unerhörte Weise, mit der deutschen Rechtschreibung getrieben wird. Die Skribler, in jeder Gattung, haben nämlich so etwas vernommen von Kürze des Ausdrucks, wissen jedoch nicht, daß diese besteht in sorgfältigem Weglassen alles Ueberflüssigen, wozu denn freilich ihre ganze Schreiberei gehört ; sondern vermeinen es dadurch zu erzwingen, daß sie die Worte beschneiden, wie die Gauner die Münzen, und jede Silbe, die ihnen überflüssig scheint, weil sie den Werth derselben nicht fühlen, ohne Weiteres abknappen. Z. B. unsere Vorfahren haben, mit richtigem Takt, »Beweis« und »Verweis«, hingegen »Nachweisung« gesagt : der feine Unterschied, analog dem zwischen »Versuch« und »Versuchung«, »Betracht« und »Betrachtung«, ist den dicken Ohren und dicken Schädeln nicht fühlbar ; daher sie das Wort »Nachweis« erfunden haben, welches sogleich in allgemeinen Gebrauch gekommen ist: denn dazu gehört nur, daß ein Einfall recht plump und ein Schnitzer recht grob sei. Demgemäß ist die gleiche Amputation bereits an unzähligen Worten vorgenommen worden : z. B. statt »Untersuchung« schreibt man »Untersuch«, ja, gar statt »allmälig, mälig«, statt »beinahe, nahe«, statt »beständig, ständig«. Unterfienge sich ein Franzose près statt presque, ein Engländer most statt almost zu schreiben ; so würde er einstimmig als ein Narr verlacht werden : in Deutschland aber gilt man durch so etwas für einen originellen Kopf. Chemiker schreiben bereits »löslich und unlöslich« statt »unauflöslich« und werden damit, wenn ihnen nicht die Grammatiker auf die Finger schlagen, die Sprache um ein werthvolles Wort bestehlen : löslich sind Knoten, Schuhriemen, auch Konglomerate, deren Cäment erweicht wird, und alles diesem Analoge : auflöslich hingegen ist was in einer Flüssigkeit ganz verschwindet, wie Salz im Wasser. »Auflösen« ist der terminus ad hoc, welcher Dies und nichts Anderes besagt, einen bestimmten Begriff aussondernd : den aber wollen unsere scharfsinnigen Sprachverbesserer in die allgemeine Spülwanne »Losen« gießen : konsequenter Weise müßten sie dann auch statt »ablösen (von Wachen), auslösen, einlösen« u. s. w. überall »lösen« setzen, und in diesem, wie in jenem Fall der Sprache die Bestimmtheit des Ausdrucks benehmen. Aber die Sprache um ein Wort ärmer machen heißt das Denken der Nation um einen Begriff ärmer machen. Dahin aber tendiren die vereinten Bemühungen fast aller unserer Bücherschreiber seit zehn bis zwanzig Jahren : denn was ich hier an einem Beispiele gezeigt habe, ließe sich an hundert andern nachweisen, und die niederträchtigste Silbenknickerei grassirt wie eine Seuche. Die Elenden zählen wahrhaftig die Buchstaben und nehmen keinen Anstand, ein Wort zu verkrüppeln, oder eines in falschem Sinne zu gebrauchen, sobald nur zwei Buchstaben dabei zu lukriren sind. Wer keiner neuen Gedanken fähig ist, will wenigstens neue Worte zu Markte bringen, und jeder Tintenklexer hält sich berufen, die Sprache zu verbessern. Am unverschämtesten treiben es die Zeitungsschreiber, und da ihre Blätter, vermöge der Trivialität ihres Inhalts, das allergrößte Publikum, ja ein solches haben, das größtentheils nichts Anderes liest ; so droht durch sie der Sprache große Gefahr; daher ich ernstlich anrathe, sie einer orthographischen Censur zu unterwerfen, oder sie für jedes ungebräuchliche, oder verstümmelte Wort eine Strafe bezahlen zu lassen : denn was könnte unwürdiger seyn, als daß Sprachumwandelungen vom allerniedrigsten Zweig der Litteratur ausgiengen? Die Sprache, zumal eine relative Ursprache, wie die Deutsche, ist das köstlichste Erbtheil der Nation und dabei ein überaus komplicirtes, leicht zu verderbendes und nicht wieder herzustellendes Kunstwerk, daher ein noli me tangere. Andere Völker haben dies gefühlt und haben gegen ihre, obwohl viel unvollkommneren Sprachen große Pietät bewiesen : daher ist Dante's und Petrarka's Sprache nur in Kleinigkeiten von der heutigen verschieden, Montaigne noch ganz lesbar, und so auch Shakespeare in seinen ältesten Ausgaben. – Dem Deutschen ist es sogar gut, etwas lange Worte im Munde zu haben: denn er denkt langsam und sie geben ihm Zeit zum besinnen. Aber jene eingerissene Sprachökonomie zeigt sich in noch mehreren charakteristischen Phänomenen: sie setzen z. B., gegen alle Logik und Grammatik, das Imperfektum statt des Perfektums und Plusquamperfektums ; sie stechen oft das Auxiliarverbum in die Tasche ; sie brauchen den Ablativ statt des Genitivs; sie machen, um ein Paar logische Partikeln zu lukriren, so verflochtene Perioden, daß man sie vier Mal lesen muß, um hinter den Sinn zu kommen : denn bloß das Papier, nicht die Zeit des Lesers wollen sie sparen : bei Eigennamen deuten sie, ganz hottentottisch, den Kasus weder durch Flexion, noch Artikel an: der Leser mag ihn rathen. Besonders gern aber eskrokiren sie die doppelten Vokale und das tonverlängernde h, diese der Prosodie geweihten Buchstäben ; welches Verfahren gerade so ist, wie wenn man aus dem Griechischen das h und w verbannen und statt ihrer e und o setzen wollte. Wer nun Scham, Märchen, Maß, Spaß schreibt, sollte auch Lon, Son, Stat, Sat, Jar, Al u. s. w. schreiben. Die Nachkommen aber werden, da ja die Schrift das Abbild der Rede ist, vermeinen, daß man auszusprechen hat, wie man schreibt : wonach dann von der Deutschen Sprache nur ein gekniffenes, spitzmäuliges, dumpfes Konsonantengeräusch übrig bleiben und alle Prosodie verloren gehn wird. Sehr beliebt ist auch, wegen Ersparniß eines Buchstabens, die Schreibart »Literatur« statt der richtigen »Litteratur«. Zu ihrer Vertheidigung wird das Particip des Verbums linere für den Ursprung des Wortes ausgegeben. Linere heißt aber schmieren : daher möchte für den größten Theil der Deutschen Buchmacherei die beliebte Schreibart wirklich die richtige seyn, so daß man eine sehr kleine Litteratur und eine sehr ausgedehnte Literatur unterscheiden könnte. – Um kurz zu schreiben, veredele man seinen Stil und vermeide alles unnütze Gewäsche und Gekaue : da braucht man nicht, des theuren Papiers halber, Silben und Buchstaben zu eskrokiren. Aber so viele unnütze Seiten, unnütze Bogen, unnütze Bücher zu schreiben, und dann diese Zeit- und Papiervergeudung an den unschuldigen Silben und Buchstaben wieder einbringen zu wollen, – das ist wahrlich der Superlativ Dessen, was man auf Englisch pennywise and poundfoolish nennt. – Zu beklagen ist es, daß keine Deutsche Akademie da ist, dem litterarischen Sanskülottismus gegenüber die Sprache in ihren Schutz zu nehmen, zumal in einer Zeit, wo auch die der alten Sprachen Unkundigen es wagen dürfen, die Presse zu beschäftigen.
(Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, S. 1337 ff. Schopenhauer-ZA Bd. 3, S. 146 ff.)
eingetragen von Reinhard Markner am 05.08.2001 um 21.52
»Wer pfuscht, darf das Rechte nicht gelten lassen: sonst wäre er gar nichts.« – Goethe.
eingetragen von Reinhard Markner am 28.06.2001 um 20.32
Der Reichskanzler fragte klüglicherweise die Masse nicht, sondern beschloß die Reform* mit wenigen Auserwählten und überließ dem Volke das Räsonnieren und die Polizeistrafen im Weigerungsfalle. Auf ähnliche Weise wird auch die Orthographie ihre praktische Regelung erfahren müssen, aber wir können uns nicht veranlaßt finden, eine Frage darum fern zu halten, weil das Volk ihr verneinend gegenüber steht.
K. Düwell, in: Zeitschrift für Orthographie 1/1880–81, S. 172
*Leider weiß ich nicht, welche Maßnahme Bismarcks gemeint ist.
eingetragen von Reinhard Markner am 08.04.2001 um 21.07
Von der Darstellung der Rede durch die Schrift als Versuch einer Rechtschreibung für die Deutschen. Berl. 1797.
Der Vf., der sich unter der Vorrede »Johann Gottfried Richter« unterzeichnet, zeigt sich in obiger Schrift als einen denkenden Kopf, wiewohl er die Gabe des leichten und geschmackvollen Vortrags nicht in einem vorzüglichen Grade besitzt. Er geht mit nichts Geringerm um, als damit, die Schreibung zur Wißenschaft, zur Rechtschreibung im strengsten Sinne des Wortes, zu erheben. Daß er an sie zu große Forderungen macht, und von dem, was sie auch bei der vollkommensten Einrichtung leisten kann, zu hohe Erwartungen hegt, beweist zum Theil schon der Titel : die Schrift kann die Rede im Grunde niemals »darstellen«, sondern nur bezeichnen. Eine Darstellung macht uns mit ihrem Gegenstande bekannt, wenn er uns auch vorher noch nie vorgekommen wäre ; die Schreibung, selbst die regelmäßigste, wo jeder verschiedne einfache Laut sein besonderes Zeichen, und zwar nur Eines hat, und wo jedes Zeichen immer einerlei bedeutet, kann uns die richtige Aussprache nicht lehren, sondern uns nur daran erinnern, wenn wir sie schon haben.
. . .
Der Vf. giebt es als einen Vortheil der von ihm vorgeschlagenen Schreibung an, daß man in den Gegenden Deutschlands, wo unrichtig ausgesprochen wird, die richtige Aussprache daraus lernen würde. Hiezu wird Können und Wollen vorausgesetzt, welches beides gröstentheils fehlt.
. . .
Der Vf. beweist seine Einsicht und Genauigkeit in der Beobachtung durch das Meiste, was er über die Aussprache sagt ; und er hätte ohne Zweifel etwas weit Nützlicheres geliefert, wenn er diese, und nicht die Rechtschreibung zum Zweck seiner Schrift gemacht, und die neue Bezeichnung bloß zum Behuf des Unterrichts in der Aussprache, wie die englischen Orthoepisten, erfunden hätte. Allein er dringt auf ihre wirkliche Einführung, ob er gleich wiederholt versichert, er theile die gutmüthige Hoffnung seiner Vorgänger, mit solchen Vorschlägen Eingang zu finden, gar nicht. Hierin hat er nun sehr recht.
. . .
(Allgemeine Literatur-Zeitung 1797 ; Sämmtliche Werke, Hg. Eduard Böcking, Bd. 11, Leipzig 1847, 177--81)
eingetragen von Reinhard Markner am 14.03.2001 um 10.26
»Meine deutsche Rechtschreibung hoffe ich als consequent rechtfertigen zu können. Das z verdopple ich nie, weil es schon doppelt ist, und auch nicht die mindeste Täuschung Statt finden kann als würde es zwiefach ausgesprochen. Das i, welches wo es gedehnt werden soll allemal das e hinter sich hat, sehe ich als seiner Natur nach kurz an und verdopple also den Consonant nicht dahinter, sofern nemlich dies bloß Accentuation ist. Hieraus werden Sie Sich das übrige erklären können. Nur mit dem k begegnet es mir aus alter Unart oft, daß ich vergesse es zu verdoppeln wo ich es meiner Regel zufolge thun sollte. So bin ich auch, freilich erst während der Ausarbeitung der Grundlinien, mit meiner Interpunction ganz aufs Reine gekommen, sündige aber im Schreiben sehr oft dagegen, und werde mir deshalb allerdings die Mühe nehmen müssen meine Handschrift bloß in dieser Hinsicht noch einmal durchzugehen. Sobald ich irgend dazu kommen kann, will ich meine Ansicht dieses Gegenstandes so kurz als möglich zu Papier bringen, und sie Ihrer Prüfung vorlegen. In deutschen Sprachlehren habe ich nirgends etwas befriedigendes darüber gefunden und in der Praxis unserer besten Schriftsteller ist mir immer vieles dunkel geblieben.«
Friedrich Schleiermacher an August Wilhelm Schlegel, 19. 5. 1804
Josef Körner (Hg.): Krisenjahre der Frühromantik. Briefe aus dem Schlegelkreis, Bd. 1, Brünn usw. 1936, S. 84
dazu Schlegel : »Ihre Orthographie befolge ich genau, wiewohl ich sie nicht zu rechtfertigen weiß ; es wäre leicht, Ihnen zu zeigen, daß Sie keine festen Grundsätze befolgen.«
***
Besuch bei Adelung, Dresden, Juni 1798 : »Noch war mir bei A. so auffallend, als irgendwo, der Unterschied zwischen dem Schriftsteller und dem Sprecher . . . Das Deutsche spricht er oft ziemlich nachlässig und gemein, anders als man nach dem Schriftsteller erwarten sollte. – A. spricht kein Französisch, kein Latein.«
Wilhelm Süss : Karl Morgenstern (1770–1852). Ein kulturhistorischer Versuch, Dorpat 1928/29, S. 94[Geändert durch Reinhard Markner am 15.03.2001, 11:44]
Alle angegebenen Zeiten sind MEZ
Rechtschreibung.com – Nachrichten zur Rechtschreibfrage